| Nr. , siehe | | 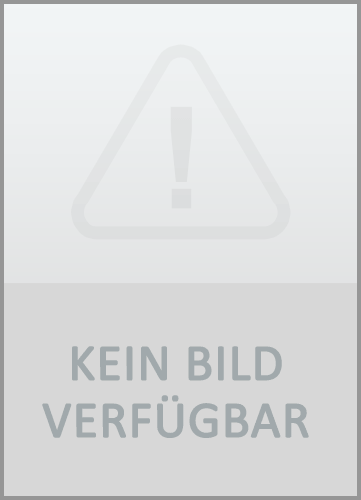 | | Absender unbekannt an Adressat unbekannt | | Brief | | | | | Vorangehend: keine | Nachfolgend: keine |
| Die Dokumente im Anhang müssen in den Grundzügen manuell ausgezeichnet werden, bis dahin ist er in seiner Gesamtheit provisorisch als Brief gekennzeichnetDer Brief an den Kronprinzen von Preussen.  Von aller Welt verlassen, immer mehr in die tiefste Hülfslosigkeit versinkend, erhebe ich meine scheue Stimme zu der Von aller Welt verlassen, immer mehr in die tiefste Hülfslosigkeit versinkend, erhebe ich meine scheue Stimme zu der  Gnade Ewr Königlichen Hoheit. Die Strafe meiner Lügen auf mein Haupt, wenn an den 5folgenden Thatsachen etwas Unwahres ist: ich bin von ziemlich armen Eltern in Lippe-Detmold geboren; sie waren schwach genug, mich auf das Gymnasium zu schicken, und ahnten nicht, daß die Weisheit des Gelehrten nur in der Form sich von der eines Schusters unterscheidet; ich überflügelte bald in den 10 Gnade Ewr Königlichen Hoheit. Die Strafe meiner Lügen auf mein Haupt, wenn an den 5folgenden Thatsachen etwas Unwahres ist: ich bin von ziemlich armen Eltern in Lippe-Detmold geboren; sie waren schwach genug, mich auf das Gymnasium zu schicken, und ahnten nicht, daß die Weisheit des Gelehrten nur in der Form sich von der eines Schusters unterscheidet; ich überflügelte bald in den 10 Wissenchaften nicht nur meine Mitschüler, sondern auch manche meiner Lehrer, und glaube noch jetzt extempore mich einer fast schrankenlosen Prüfung unterwerfen zu können; da aber mein Geist bei seinem inneren Wachsthume sich auch äußerlich entfalten mußte und dieß im jugendlichen Übermuthe auf 15eine vielleicht zu gewaltsame Weise geschah, so konnten meine ein wenig kleinstädtischen Landsleute Wissenchaften nicht nur meine Mitschüler, sondern auch manche meiner Lehrer, und glaube noch jetzt extempore mich einer fast schrankenlosen Prüfung unterwerfen zu können; da aber mein Geist bei seinem inneren Wachsthume sich auch äußerlich entfalten mußte und dieß im jugendlichen Übermuthe auf 15eine vielleicht zu gewaltsame Weise geschah, so konnten meine ein wenig kleinstädtischen Landsleute  das nicht fassen, und ich merkte, daß es um meine lippische Laufbahn gethan war; weil ich indeß einmal angefangen hatte, so durfte und konnte ich nicht sogleich wieder aufhören, und ich eilte nach Leipzig, 20um daselbst die Rechte zu studiren, welches ich denn auch so redlich gethan habe, daß ich mich vor keinem Examen zu fürchten brauche; jetzt hatten jedoch meine unglücklichen Eltern das letzte Geld für mich aufgewendet, das nicht fassen, und ich merkte, daß es um meine lippische Laufbahn gethan war; weil ich indeß einmal angefangen hatte, so durfte und konnte ich nicht sogleich wieder aufhören, und ich eilte nach Leipzig, 20um daselbst die Rechte zu studiren, welches ich denn auch so redlich gethan habe, daß ich mich vor keinem Examen zu fürchten brauche; jetzt hatten jedoch meine unglücklichen Eltern das letzte Geld für mich aufgewendet,  und da ich bei meinen schlechten Aussichten in der Heimath, kein andres 25Mittel wußte, so schrieb ich in meinem Schmerze ein Trauerspiel, für welches ich wegen seiner Sonderbarkeit einen hohen Preis zu erhalten dachte; aber obwohl bloß wegen dieses Stückes bedeutende Männer auf mich aufmerksam geworden sind und selbst Briefwechsel mit mir angefangen haben, so 30fehlte es mir bis auf Hut und Schuhe an und da ich bei meinen schlechten Aussichten in der Heimath, kein andres 25Mittel wußte, so schrieb ich in meinem Schmerze ein Trauerspiel, für welches ich wegen seiner Sonderbarkeit einen hohen Preis zu erhalten dachte; aber obwohl bloß wegen dieses Stückes bedeutende Männer auf mich aufmerksam geworden sind und selbst Briefwechsel mit mir angefangen haben, so 30fehlte es mir bis auf Hut und Schuhe an  allem Äußeren, um es einem anständigen Verleger auf die gehörige Weise anzubieten; allem Äußeren, um es einem anständigen Verleger auf die gehörige Weise anzubieten; [GAA, Bd. VI, S. 362] da übermannte mich die ausgelassenste Lustigkeit, und ich schrieb mit einem abgebrochenen Schwefelhölzchen, welches ich in Ermangelung einer Feder in die Tinte tauchte, das Lustspiel nieder, welches ich als Probe meines Talentes hier 5beizulegen wage. Jetzt galt es aber, meine letzten Kräfte für meine Erhaltung aufzubieten,  und ich erinnerte mich meiner Anlage für die Schauspielkunst, die so groß zu seyn scheint, daß es mährchenhaft lautete, wenn ich ohne einen näheren, persönlichen Beweis davon sprechen wollte; ich eilte also voll 10sicherer Hoffnung nach Berlin und — konnte es daselbst nicht einmal so weit bringen, daß ich zu irgend einer kurzen Probedarstellung im Zimmer gelassen wurde! Ewr Königliche Hoheit haben nun gewiß und ich erinnerte mich meiner Anlage für die Schauspielkunst, die so groß zu seyn scheint, daß es mährchenhaft lautete, wenn ich ohne einen näheren, persönlichen Beweis davon sprechen wollte; ich eilte also voll 10sicherer Hoffnung nach Berlin und — konnte es daselbst nicht einmal so weit bringen, daß ich zu irgend einer kurzen Probedarstellung im Zimmer gelassen wurde! Ewr Königliche Hoheit haben nun gewiß  schon ersehen, was ich für ein Mensch bin. Viele nannten mich genial, ich 15weiß indeß nur, daß ich wenigstens Ein Kennzeichen des Genies besitze, den Hunger. Nochmals erhebe ich meine Stimme zu Ewr Königlichen Hoheit! II. Verlags-Kontrakte A. 20 schon ersehen, was ich für ein Mensch bin. Viele nannten mich genial, ich 15weiß indeß nur, daß ich wenigstens Ein Kennzeichen des Genies besitze, den Hunger. Nochmals erhebe ich meine Stimme zu Ewr Königlichen Hoheit! II. Verlags-Kontrakte A. 20 Contract zwischen dem Herrn Auditeur Grabbe in Detmold und der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung in Frankfurt a/m über die schriftstellerischen Arbeiten desselben. 1) Der Herr Auditeur Grabbe in Detmold überläßt alle und 25jede literarische Arbeiten, die er in den nächsten 4 Jahren vom 1sten Januar 1830 an gerechnet liefern wird, der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung zum eigenthümlichen Verlage und verpflichtet sich binnen dieser Zeit, also bis zum 1sten Januar 1834 mit keiner anderen Buchhandlung hinsichtlich 30seiner in diese Periode fallenden schriftstellerischen Erzeugnisse in Verbindung zu treten. 2) Er verspricht der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung im Laufe eines jeden Jahres mindestens 3 dramatische Stücke im ungefähren Umfang wie sein Anfang 1829 erschienener 35Don Juan und Faust zu liefern, und zwar würden in den 3 ersten Jahren 2 Stücke hiervon jedesmal die Fortsetzung des von ihm begonnenen Cyclus von Tragödien „die Hohen- Contract zwischen dem Herrn Auditeur Grabbe in Detmold und der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung in Frankfurt a/m über die schriftstellerischen Arbeiten desselben. 1) Der Herr Auditeur Grabbe in Detmold überläßt alle und 25jede literarische Arbeiten, die er in den nächsten 4 Jahren vom 1sten Januar 1830 an gerechnet liefern wird, der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung zum eigenthümlichen Verlage und verpflichtet sich binnen dieser Zeit, also bis zum 1sten Januar 1834 mit keiner anderen Buchhandlung hinsichtlich 30seiner in diese Periode fallenden schriftstellerischen Erzeugnisse in Verbindung zu treten. 2) Er verspricht der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung im Laufe eines jeden Jahres mindestens 3 dramatische Stücke im ungefähren Umfang wie sein Anfang 1829 erschienener 35Don Juan und Faust zu liefern, und zwar würden in den 3 ersten Jahren 2 Stücke hiervon jedesmal die Fortsetzung des von ihm begonnenen Cyclus von Tragödien „die Hohen- [GAA, Bd. VI, S. 363] staufen“, welches Werk auf 8 Bände berechnet ist, bis zur Vollendung desselben nach diesem Umfange ausmachen. 3) Die Joh. Christ. Hermann'sche Buchhandlung verpflichtet sich dagegen dem Herrn Auditeur Grabbe für diese seine 5dramatischen Arbeiten monatlich eine Summe von rthlr. 24: —. Preuß. Court. zu bezahlen, über welchen Betrag derselbe durch Anweisung von seinem Wohnort aus verfügen wird.  4) Wird Herr Auditeur Grabbe, das von ihm begonnene dramatische Werk „die Hohenstaufen“, von welchem der 1ste 10Band Kaiser Friedrich Barbarossa bereits erschienen, und dessen 2r Theil Kaiser Heinrich VI demnächst erscheinen soll, vom 3ten Theile an bis zum letzten 8ten Theile binnen 3 Jahren vom 1sten Januar 1830 an gerechnet, vollenden, also jährlich davon 2 Bände liefern, so verpflichtet sich die Joh. Christ. 15Hermann'sche Buchhandlung unter Voraussetzung, daß diese späteren Theile im gleichen Geiste, wie der erste Theil Kaiser Friedrich Barbarossa gearbeitet sind, zu einem Extra-Honorar von rthlr. 100: —. Preuß. Court. für jeden einzelnen Band, vom 3ten Band an gerechnet. 205) Gefällt es dem Herrn Auditeur Grabbe außer diesen poetischen Arbeiten sich noch mit anderweitigen Arbeiten in Prosa zu beschäftigen, so verspricht er ebenfalls dieselben innerhalb des obigen Termines bis zum 1sten Januar 1834 der Hermann'schen Buchhandlung nicht zu entziehen, und diese dagegen verpflichtet 25sich ihm ein im Verhältniß mit seinen übrigen Leistungen angemessenes Honorar dafür zu bezahlen. 6) Der Herr Auditeur Grabbe gewährt der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung die Freiheit ihm Arbeiten, die ihr für den Druck nicht geeignet scheinen zu refüsiren, und würde 30dann Herr Auditeur Grabbe statt der ausfallenden Arbeiten entweder neue liefern, oder wo nicht, der verhältnißmäßige 4) Wird Herr Auditeur Grabbe, das von ihm begonnene dramatische Werk „die Hohenstaufen“, von welchem der 1ste 10Band Kaiser Friedrich Barbarossa bereits erschienen, und dessen 2r Theil Kaiser Heinrich VI demnächst erscheinen soll, vom 3ten Theile an bis zum letzten 8ten Theile binnen 3 Jahren vom 1sten Januar 1830 an gerechnet, vollenden, also jährlich davon 2 Bände liefern, so verpflichtet sich die Joh. Christ. 15Hermann'sche Buchhandlung unter Voraussetzung, daß diese späteren Theile im gleichen Geiste, wie der erste Theil Kaiser Friedrich Barbarossa gearbeitet sind, zu einem Extra-Honorar von rthlr. 100: —. Preuß. Court. für jeden einzelnen Band, vom 3ten Band an gerechnet. 205) Gefällt es dem Herrn Auditeur Grabbe außer diesen poetischen Arbeiten sich noch mit anderweitigen Arbeiten in Prosa zu beschäftigen, so verspricht er ebenfalls dieselben innerhalb des obigen Termines bis zum 1sten Januar 1834 der Hermann'schen Buchhandlung nicht zu entziehen, und diese dagegen verpflichtet 25sich ihm ein im Verhältniß mit seinen übrigen Leistungen angemessenes Honorar dafür zu bezahlen. 6) Der Herr Auditeur Grabbe gewährt der Joh. Christ. Hermann'schen Buchhandlung die Freiheit ihm Arbeiten, die ihr für den Druck nicht geeignet scheinen zu refüsiren, und würde 30dann Herr Auditeur Grabbe statt der ausfallenden Arbeiten entweder neue liefern, oder wo nicht, der verhältnißmäßige  Betrag des Honorars dafür in Abzug gebracht werden; ferner gesteht er der Verlagshandlung das Recht zu, wenn er bis zum Verlauf von 4 Monaten von Eingang des letzten Manuscriptes 35an kein neues Stück übersandt, mit Zahlung der monatlichen rthlr: 24 einzuhalten. 7) Alles, was Herr Auditeur Grabbe in der übereingekommenen Zeit in Poesie und Prosa der Hermann'schen Buchhandlung unter den angeführten Bedingungen liefert, gehört 40derselben als volles Eigenthum für beständig und für alle und jede Auflagen. Betrag des Honorars dafür in Abzug gebracht werden; ferner gesteht er der Verlagshandlung das Recht zu, wenn er bis zum Verlauf von 4 Monaten von Eingang des letzten Manuscriptes 35an kein neues Stück übersandt, mit Zahlung der monatlichen rthlr: 24 einzuhalten. 7) Alles, was Herr Auditeur Grabbe in der übereingekommenen Zeit in Poesie und Prosa der Hermann'schen Buchhandlung unter den angeführten Bedingungen liefert, gehört 40derselben als volles Eigenthum für beständig und für alle und jede Auflagen. [GAA, Bd. VI, S. 364] 8) Sämmtliche aus diesem Contrakt für beide Theile entspringenden Rechte und Verbindlichkeiten gehen, in so fern dies ihrer Natur nach möglich, auf die beiderseitigen Erben über. Zur sicheren Beglaubigung wurde dieser Contrakt in duplo 5von den beiden contrahirenden Theilen unterschrieben und besiegelt. Frankfurt a/M den 15ten August 1829 Joh Christ. Hermann'sche Buchhandlung 10  Obigen Contract nehme ich unter folgenden Modificationen an, a) daß es mir unbehindert bleibt, Aufsätze, auch Probescenen aus meinen dramatischen Stücken, in geeignete Journale zu senden, 15 b) daß, wenn über die Frage, ob ein Stück der Hohenstaufen im Geist des Barbarossa geschrieben sey, [keine Einigung unter den Vertrags-Partnern zu erzielen ist,] dieses durch von beiden Theilen vorzuschlagende Kunstverständige ermittelt werde, 20 c) daß, falls Zwiespalt über das Honorar etwaiger prosaischer Arbeiten entstände, gleichfalls Kunst- und Sachverständige, von beiden Theilen zu wählen, denselben entscheiden, — d) daß ich zwar die vom 1st Januar 1830 bis zum 1st Januar 1834 von mir in der Hermann'schen Buchhandlung 25erscheinenden Werke, letzterer zum Eigenthum hinsichts aller Auflagen übertrage, jedoch mir bei jeder etwaigen neuen Auflage eines einzelnen Stückes eine Vergütung von 90 rthlr. Pr. C., sämmtlicher oder mehrerer Stücke hingegen eine hiernach zu erhöhende (pro jedes Stück 90 rthlr.) ertheilt werde, — 30 e) daß ich die refusirten Stücke andren Buchhandlungen übertragen darf. Obigen Contract nehme ich unter folgenden Modificationen an, a) daß es mir unbehindert bleibt, Aufsätze, auch Probescenen aus meinen dramatischen Stücken, in geeignete Journale zu senden, 15 b) daß, wenn über die Frage, ob ein Stück der Hohenstaufen im Geist des Barbarossa geschrieben sey, [keine Einigung unter den Vertrags-Partnern zu erzielen ist,] dieses durch von beiden Theilen vorzuschlagende Kunstverständige ermittelt werde, 20 c) daß, falls Zwiespalt über das Honorar etwaiger prosaischer Arbeiten entstände, gleichfalls Kunst- und Sachverständige, von beiden Theilen zu wählen, denselben entscheiden, — d) daß ich zwar die vom 1st Januar 1830 bis zum 1st Januar 1834 von mir in der Hermann'schen Buchhandlung 25erscheinenden Werke, letzterer zum Eigenthum hinsichts aller Auflagen übertrage, jedoch mir bei jeder etwaigen neuen Auflage eines einzelnen Stückes eine Vergütung von 90 rthlr. Pr. C., sämmtlicher oder mehrerer Stücke hingegen eine hiernach zu erhöhende (pro jedes Stück 90 rthlr.) ertheilt werde, — 30 e) daß ich die refusirten Stücke andren Buchhandlungen übertragen darf. | Detmold den | | Grabbe. | | 20st August. 1829. | | |
B. 35 Zwischen dem Herrn Landgerichtsrath Immermann dahier, als Special-Bevollmächtigtem des Herrn Auditeurs Grabbe und dem Herrn Buchhändler I.[ohann] H.[einrich] C.[hristian] Schreiner ebenfalls dahier ist nachstehender Verlags-Contract abgeschlossen worden: [GAA, Bd. VI, S. 365] 1. Herr Schreiner übernimmt das Werk des Herrn Grabbe „Aschenbrödel, Lustspiel in 4 Aufzügen“ in Verlag, läßt dieses Werk sogleich drucken und giebt nach Beendigung des Drucks 5dem Herrn Verfasser fünfzehn Freiexemplare auf feinerm Papier. 2. An Honorar erhält der Herr Verfasser Fünfzig Thaler in Golde bei Aushändigung des Manuscripts ausgezahlt. 103. Die Stärke der Auflage wird auf Eintausend Exemplare bestimmt. 4. Die Correctur übernimmt der Herr Verfasser. 15 Vorstehender Contract ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und von den Partheien zum Zeichen der Genehmigung eigenhändig unterschrieben worden. | | | Düsseldorf, den 16ten Januar 1835. | | Immermann. | | I. H. C. Schreiner. |
20C. Zwischen dem Herrn Landgerichts-Rath Immermann, als Spezialbevollmächtigten des Herrn Auditeur Grabbe und dem Buchhändler I.[ohann] H.[einrich] C.[hristian] Schreiner, beide dahier wohnhaft, ist nachstehender Verlags Contract abgeschlossen 25worden: Art. 1. Der Herr Landgerichts-Rath Immermann im Namen und Auftrage des Herrn Auditeur Grabbe überträgt dem Buchhändler Schreiner das Verlags-Recht an der Tragödie: Han- 30nibal, des genannten Verfassers. Art. 2. Dieses Verlags-Recht bezieht sich auf die 1te Auflage, deren Stärke zu Eintausend Exemplaren bestimmt wird. Art. 3. 35 Der Buchhändler Schreiner zahlt ein Honorar von / Einhundert Thalern in Golde / bei Empfangnahme der Handschrift, giebt außerdem fünfzehn frei Exemplare dem Herrn Verfasser auf feinem Papier, sobald der Duck beendigt ist. [GAA, Bd. VI, S. 366] Art. 4. Mit dem Drucke wird sogleich begonnen, und derselbe in thunlichst kürzester Frist zu Ende geführt. Also von beiden Theilen verabredet, und ist gegenwärtiger Contract, in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt, 5zum Zeichen der Genehmigung von den Contrahenten unterschrieben worden. Düsseldorf den 21. Februar. 1835. K. Immermann. I. H. C. Schreiner. 10 III. Acta in causa Auditeur Grabbe und Forst secretair Kestner, puncto injuriarum. (Fragment.) 15 Einleitung. Am 1. Juli 1833 erschien Louise Christiane, die am 6. März des gleichen Jahres Grabbes Gattin geworden war, mit einem verschlossenen Kasten bei ihrer Freundin, der Frau des Forstsekretärs Kestner in Detmold, und bat sie, diesen Kasten mit 20Gelde in Verwahrung zu nehmen, mit der Begründung: „daß sie zwar mit ihrem Ehemann in Gütergemeinschaft lebe, derselbe ihr jedoch die Verwaltung des von ihr inferirten Vermögens zu belassen versprochen habe 1, daß das Geld ihr gehöre, daß dasselbe zum Einsatz in eine Witwen-Casse bestimmt 25und bisher dazu aufbewahrt sey“, Grabbe jedoch nun gegen ihren Willen auf andere Art darüber disponieren wolle 2. Im gleichen Augenblicke kam Kestner selbst von einem Spaziergange zurück und ließ, um der größeren Sicherheit willen, den Kasten in seine Arbeitsstube bringen. 30 Bald darauf hatte Grabbe in Erfahrung gebracht, daß der Kasten, welcher annähernd 300 Rtlr. enthielt, weggeschafft worden, und auch, zu wem er gekommen war. So erhielt am folgenden Tage, also am 2. Juli, Kestner von ihm einen [GAA, Bd. VI, S. 367] Brief, in dem die Herausgabe des Kastens sowie die Beantwortung verschiedener Fragen begehrt wurde. Der Forstsekretär erwiderte, daß ihm der Kasten allerdings, nicht aber andere Sachen anvertraut worden seien, daß er sich jedoch 5nicht für berechtigt halte, ihn jemand anders auszuliefern, als Louisen. Darauf traf, nachdem er diese bereits zur Rücknahme des Kastens aufgefordert, auch ihre Zusage erhalten hatte, am 3. Juli ein zweites Schreiben Grabbes bei ihm ein, dessen Gründe indes seine Ansicht nicht zu ändern vermochten, 10daß er verpflichtet sei, den fraglichen Kasten nur der Überbringerin zurückzugeben. Dieses geschah noch am nämlichen Tage. Grabbe wurde davon sogleich benachrichtigt. Kestner bemerkte dazu, daß er nun auch faktisch außer Stande sei, dem Verlangen Grabbes zu genügen, daß er übrigens 15vermuten müsse, Grabbe werde bei ruhigem Nachdenken wohl das beste Mittel finden, den Kasten wieder ins Haus zu schaffen, daß Nachgibigkeit gegen billige Forderungen auch dem Manne nicht Schimpf, sondern Ehre bringe u.s.w. Diese Mitteilung beantwortete Grabbe mit einem dritten Briefe, der 20vom 4. Juli datiert war und, wie Kestner angibt, außer einigen Grobheiten, wie z. B. der Behauptung, daß das ganze Deutschland ihn besser kenne und höher schätze, als Kestner geschätzt werde, gleich zu Anfang den Hinweis auf eine Angelegenheit enthielt, mit der es folgende Bewandtnis hatte: 25Eine Geldrolle im Betrage von etwa neun Rtlrn. war von dem Regierungsfiskal Rat Antze in Detmold, der die Summe eigenhändig auf dem Papier bemerkt hatte, an den Leutnant Steffen, von diesem an den Kaufmann Wist, von diesem an den Forstsekretär Kestner und von diesem endlich an den Kornhändler 30Austermann ausgegeben worden. Dieser letzte Empfänger öffnete sie, zählte sie in Gegenwart des Überbringers nach und stellte fest, daß an dem angegebenen Betrage etwas fehlte. Darauf erhielt Kestner die Tute mit dem darin gefundenen Gelde zurück, gab sie seinerseits an den Kaufmann Wist 35weiter und erhielt von diesem ohne weiteres den darauf bemerkten Betrag in anderem Gelde. Dagegen weigerte sich der Leutnant Steffen, die Tute von Wist zurückzunehmen und nötigte diesen dadurch, ihn beim Militärgerichte zu verklagen. Dies geschah am 18. Juni 1832, und so erscheint denn die 40Sache in der Prozeßtabelle vom gleichen Monat (unter Nr. 14) mit dem Bemerken: „Implorat verneint die Foderung, und [GAA, Bd. VI, S. 368] wird die Sache im Laufe dieses Monats wohl verglichen werden, so mehr als partes Evictionsleistungen 3 von Dritten glauben fodern zu können.“ Diese Voraussage traf jedoch nicht ein. Darum wurde dem Imploranten, Kaufmann Wist, der 5Beweis seiner Forderung aufgegeben, und dieser wurde am 4. Juli angetreten. Da nun Kestner Jurist, und über das Sachverhältnis am genauesten unterrichtet war, so hatte ihn Wist gebeten, die Klage und noch ein paar andere Eingaben zu entwerfen. Kestner 10hatte diesen Wunsch erfüllt, weil er annahm, Wist werde seines Zeugnisses in diesem Prozesse nicht bedürfen. Dies war nachher doch der Fall, und nun trug der Forstsekretär freilich Bedenken, als Zeuge für den Kläger aufzutreten. Diese Bedenken wurden ihm jedoch durch den Rat eines erfahrenen 15Kollegen zerstreut. So erschien er denn am 23. August mit den anderen, von Wist vorgeschlagenen Zeugen vor Gericht, unterließ es dabei aber nicht, dem Gerichte Anzeige davon zu machen, daß er die Schriften des Klägers verfaßt habe. Der außer dem Militärrichter Grabbe allein anwesende Verklagte, Leutnant 20Steffen, fand indes jene Bedenklichkeiten unerheblich. Termin zur mündlichen De- und Gegendeduktion wurde auf den 13. September angesetzt, am Ende aber die Sache unter beiden Teilen verglichen, da der Gegenstand des Streites, nämlich der Fehlbetrag der Geldtute, auf einem Mißverständnis beruhte 25und durch einen Dritten ersetzt wurde. Diesen Vorfall also zog Grabbe in seinem Briefe vom 4. Juli nach einem Jahre wieder hervor, und zwar, wie Kestner in seiner Klagschrift behauptet, in hämischer Weise, entstellt und mit der Absicht, den Gegner an seiner Ehre zu 30kränken. Er wurde deshalb von Kestner am 7. Juli 1833 bei der Justizkanzlei in Detmold wegen Beleidigung verklagt und Termin zur Verhandlung auf den 29. Juli angesetzt. Auch der Streit zwischen Grabbe und dessen Frau hatte sich verschärft. Jener stellt auffallenderweise noch am 10. Juli 35die Sache so dar, als sei der fragliche Kasten noch nicht wieder im Hause 4, und selbst am 16. Juli, in dem Augenblicke, da er zum dritten Male in dieser Sache an den Regierungsrat [GAA, Bd. VI, S. 369] von Meien schrieb, vermutete er es nur, war dessen aber nicht gewiß. 5 Auf jeden Fall drohte er, eine Anzeige in das Lippische Intelligenzblatt einzurücken, die etwa den Inhalt gehabt haben wird: er warne hiermit jedermann, von seiner Gattin, 5Louise Christiane Grabbe, geb. Clostermeier, irgend etwas anzunehmen, da er sich sonst genötigt sehen werde, gegen den Betreffenden vorzugehn. Es war darüber offenbar zu einer häuslichen Szene gekommen, in deren Verlaufe Louise Christiane ihrem Manne das Blatt gewaltsam aus den Händen 10gerissen hatte. Sie wußte natürlich, daß die geplante Anzeige sie vor der Öffentlichkeit in der empfindlichsten Weise bloßstellen müsse. Auch dem Regierungsrat von Meien konnte es nicht gleichgültig sein, wenn sein Auditeur an einem gesellschaftlichen Skandale beteiligt war, und er versuchte deswegen, 15zwischen den Ehegatten zu vermitteln. Er erhielt darauf von Grabbe in der Zeit vom 10. bis zum 16. Juli drei Briefe, aus denen sich die Voraussetzungen des Streites und Grabbes Standpunkt mit ziemlicher Deutlichkeit ergeben. Bevor Grabbe die Ehe mit Louise Christiane Clostermeier 20geschlossen hatte, war zwischen ihnen Gütergemeinschaft vereinbart worden. Louise Christiane selbst hatte sie gewünscht, und solchem Verlangen waren Grabbes eigene Anschauungen über diese Frage günstig. Die Gütergemeinschaft, so schrieb er unterm 10. Juli 1833 an den Regierungsrat, interessiere 25ihn besonders insofern, als er dadurch ein eigentümlicheres Interesse habe, für das Gesamtgut zu sorgen, als wenn keine da wäre. Viele Beispiele zeigten, daß ein gemeiner Mensch bei getrennten Gütern seine Frau und seine Gläubiger weit eher als bei ungetrennten betrüge. 6 30 Kapital war von beiden Seiten eingebracht worden; von ihrer Seite das größere. Grabbe behauptet, nicht einmal zu wissen, worin das Vermögen seiner Frau bestehe; Prorektor Clemen in Lemgo gab es im Jahre 1834 mit etwa 8—10_000 Rtlrn. an. 7 Grabbe stand das Recht der Verwaltung und 35Nutznießung des Gemeingutes zu. Jedoch hatte er offenbar in mündlichem Übereinkommen auf einen Teil seiner Rechte [GAA, Bd. VI, S. 370] zu Gunsten seiner Frau verzichtet. Er hatte ihr die Verwaltung ihres Eingebrachten überlassen, ferner seine Gage und die von ihm aus ihrem Eingebrachten genommenen Zinsen. Ausdrücklich versicherte er, von seiner Frau Vermögen nichts 5verbraucht zu haben. Bei solcher Großzügigkeit mußte es ihn empören, daß Louise Christiane über 300 Rtlr. verschleppte und damit seiner Aufsicht entzog. Er betrachtete diesen Schritt als eine Verletzung seiner ehemännlichen Rechte und mußte bei dem 10herrischen Charakter seiner Frau, die er selbst „einen kleinen Napoleon“ nennt, „indem sie alles, was man ihr bewilligt, als ein erobertes Terrain zu benutzen versteht, wovon aus sie mehr erobern kann“, befürchten, daß es mit seinem Ansehen in der Ehe für alle Zeiten vorbei sein werde, wenn er jetzt, 10anstatt den Herrn zu zeigen, nachgebe, da sie dies nicht als Gutwilligkeit, sondern als ein von Grabbe eingesehenes Unrecht behandeln werde. Mit einer schönen Objektivität erkannte Grabbe an, daß seine Frau „von Herzen gut“ sei, ja sogar „weit besser“ wie 20er selbst, dessen Herz schlechter sein möge als das ihrige. Jedoch hatte er in den wenigen Monaten der jungen Ehe auch bereits ihre fatalen Eigenschaften erkannt: daß sie „sehr eigen“ sei und „alles im übertriebenen Maßstabe“ nehme, mehr als er selbst dies tue, daß sie nicht so klug sei wie er, aber eine 25Frau mit „ausdehnender Erfindungskraft“, eine „Denkgläubige“ , indem sie so ziemlich alles glaube, was sie denke, so daß man ihrem „vielleichtigen Sprechen“ mit Mißtrauen begegnen müsse. Auch was Grabbe an dem Verhalten des Forstsekretärs zu tadeln fand, machte er dem Regierungsrate bekannt: Hätte 30er, so schreibt er, den Kasten mir überliefert, so würde ich zu meiner Frau gesagt haben: sieh, hier ist der Kasten mir überliefert, und muß- te das mir als Ehemann geschehen, und dann: 35 da ich mein Recht dir gezeigt habe, mache damit, was du willst. Statt so Versöhnung zu befördern, hat der Forstsekretär Kestner sich auf halbe Maßregeln eingelassen, aus denen stets wenig und nur Schädliches entspringt.“ 40 Grabbe hatte den Wunsch, es möge alles gut gehen. Denn es gelüstete ihn nicht, „unter der Kategorie einiger anderen [GAA, Bd. VI, S. 371] Weiberverläufer“ zu stehen, d. h. solcher, die ihrer Frau davonlaufen. Darum war er erbötig, die Anzeige im Intelligenzblatte zu unterlassen oder doch nicht ohne vorherige Anfrage beim Regierungsrate einzurücken. Sodann sollte es, 5sobald nur erst „der unselige Kasten“ wieder ins Haus geschafft sei, zwischen ihm und seiner Frau in jeder Art beim früheren bleiben, und sie verwalten, wie sie wolle, sofern sie dem Gemeingute nicht schade. Zum Beweise dessen, daß es ihm damit Ernst sei, lieferte er die gerade fälligen einundzwanzig 10Reichstaler Zinsen Louisen zurück. Am 29. Juli 1833 traten sich also die beiden Gegner vor den Schranken des Gerichts gegenüber. Gleich zu Anfang machte der leitende Richter, Kanzleirat Althof, den Versuch, die Sache gütlich beizulegen, jedoch ohne Erfolg. Grabbe erwiderte, 15daß er schon längst entschlossen gewesen sei, den Kläger gerichtlich zu belangen. Aus diesen Worten muß darauf geschlossen werden, daß die Feindschaft zwischen den beiden Männern älteren Datums war; jedoch wissen wir über ihre Gründe gar nichts. Grabbe gab also seine Erklärungen zu der 20Klagschrift ab. Insbesondere führte er aus: er habe den Forstsekretär auf keine Weise beleidigt. Alles, was er getan oder geschrieben, sei lediglich durch Kestners Verhalten provoziert worden, also, wie wir heute sagen würden, in Wahrung berechtigter Interessen geschehen. Um den weggebrachten Kasten 25wiederzuerlangen, habe ihm ein anderer, die Hilfe der Behörden umgehender Weg nicht offen gestanden. Darum erhalte der Gegner nicht, wie er gefordert, Widerruf und Abbitte, Ehrenerklärung und Ersatz der Kosten. Dagegen stelle er nun Widerklage an. Denn indem der 30Gegner dadurch, daß er wissentlich einen aus einem wohlhabenden Haushalte stammenden Kasten bewahrt und zurückgehalten habe, dessen Inhalt er zwar angeblich nicht gekannt, von dem er aber gewußt habe, daß er über 300 Rtlr. an Gelde enthalte, habe er äußerst gesetzwidrig gehandelt, auch 35ihn, den Ehemann, durch diese Einmischung in seine Vermögensverhältnisse zwischen ihm und seiner Frau äußerst beleidigt und ihm an seinem öffentlichen Kredite Schaden zugefügt. Die Frage nach der, weder aus dem Aktenfragment noch 40aus anderen Quellen sich ergebenden richterlichen Entscheidung ist zugleich die, wie das Verhalten der beiden Prozeßgegner [GAA, Bd. VI, S. 372] zu beurteilen sei. Sie kann indes nur unvollkommen beantwortet werden, da die zwischen den Parteien gewechselten Briefe vernichtet, zum mindesten nicht bekannt sind. Bei dieser Beurteilung ist davon auszugehen, daß in der Ehe 5Grabbes die Gütergemeinschaft galt, ihm daher das Recht der Administration des Gemeingutes zustand. Zwar behauptet Louise Christiane, ihr Ehemann habe ihr vor der Ehe die freie Verfügung über ihr Eingebrachtes zugestanden, wäre sie aber von der Rechtsverbindlichkeit dieser mündlichen, unverbrieften 10Versprechen überzeugt gewesen, dann würde sie nicht in ihren nach Düsseldorf gerichteten Briefen mit so bemerkenswerter Hartnäckigkeit Grabbe vor die Wahl gestellt haben: entweder in die Aufhebung der Gütergemeinschaft zu willigen oder auf das Vorrecht der Administration des Gemeingutes 15gerichtlich zu verzichten. Wenn also Louise Christiane hinter dem Rücken ihres Mannes eine nicht unbeträchtliche Summe aus dem Hause fortund zu einer dritten Person brachte, um sie nach ihrem Willen zu verwenden, so entzog sie damit dieses Kapital Grabbes 20gesetzlichem Verfügungsrechte und brachte einen Zweifel in seinen guten Willen oder auch in seine Fähigkeit zum Ausdruck, das Gemeingut ordnungsgemäß und sinnvoll zu verwalten, durch den sich Grabbe, von seiner Ehepartnerin volles Vertrauen fordernd, mit Recht gekränkt fühlen mußte. 25 Ein Gleiches gilt von dem Verhalten des Fortsekretärs Kestner. Denn objektiv ist dessen Handlungsweise als ein Eingriff in Grabbes ehemännliche Rechte anzusehen. Grabbe besaß ein sehr verletzliches Ehr- und ein sehr feines Rechtsgefühl. So sah er sich auch von Seiten eines Dritten beleidigt, der sich 30in seine persönlichen Angelegenheiten einmischte, und durfte sich dagegen wohl zur Wehr setzen. Eine andere Frage ist die, ob man diesen Eingriff subjektiv für gerechtfertigt halten muß. Kestner hat dies offenbar getan. Er hielt die Frau Auditeurin für eine im höchsten Grade redliche 35und achtungswürdige Person und schenkte deshalb ihren Behauptungen Glauben. So konnte er — ob mit Recht oder Unrecht, bleibe dahingestellt — seine Handlungsweise für berechtigt halten. Auf jeden Fall hat ihm, modern ausgedrückt, bei dem Zurückhalten des Kastens das Bewußtsein der Widerrechtlichkeit 40gefehlt. Das fühlte Grabbe wohl auch; denn er verteidigte sich. Eine Bestrafung Kestners wegen Beleidigung [GAA, Bd. VI, S. 373] wäre darnach wohl kaum eingetreten. Die Rechte Grabbes auf Schadenersatz bleiben davon unberührt. Befremdlich bleibt freilich, daß er, der kein Laie, sondern Jurist und obendrein kein Anfänger war, die Mahnung: 5„Audiatur et altera pars!“ so gänzlich außer acht gelassen hat, und daß er ferner das Bedenkliche im Verhalten der Freundin seiner Frau völlig übersehen zu haben scheint. Denn es lag nahe, ihr dies vorzustellen und mit dem Rate zu verknüpfen, den Kasten lieber wieder mit nach Hause zu nehmen. 10Der Forstsekretär läßt in seinem Verhalten Lebensklugheit und Bedachtsamkeit vermissen. Bei seiner Einsicht in die Natur beider Eheleute hätte er wohl nicht verkennen dürfen, daß es Öl ins Feuer gießen hieß, wenn er sich parteiisch in ihren Streit mengte, und es besser war, unbeteiligt zu bleiben. Vielleicht, 15daß seine Animosität gegen Grabbe ihm den Blick getrübt hat. Was Grabbe angeht, so erhebt sich zunächst die Frage, ob er Anlaß hatte, sich durch Kestners Verhalten beleidigt zu fühlen. Dabei ist zu scheiden zwischen der Annahme und Zurückhaltung 20des Kastens und der Nachricht, in der er Grabbe „ruhiges Nachdenken“ empfahl usw. Aus dem im vorigen Abschnitte Gesagten ergibt sich, daß an sich das Zurückhalten des Kastens nur gesuchtermaßen als eine Beleidigung auszulegen ist. Denn zu einer solchen gehört, wenigstens nach heutigen 25Anschauungen, wenn auch die Beleidigungsabsicht nicht gefordert wird, so doch das Bewußtsein, daß die Handlung beleidigend sei. Beleidigen wollen hat Kestner den Auditeur durch das Zurückhalten des Kastens wohl sicherlich nicht. Andererseits mußte er sich denken können, daß das Zurückhalten 30des Kastens nicht gerade ein Ausdruck des Vertrauens, vielmehr des Mißtrauens war. Insofern konnte eine Beleidigung wohl konstruiert werden. Wenn aber Kestner, wie schon erwähnt, sich auch nur für berechtigt halten konnte, den Kasten für die Frau Grabbes gegen diesen zu sichern, so würde 35seine Bestrafung wegen Beleidigung ausgeschlossen gewesen sein. Anders steht es mit dem Anspruche auf Schadenersatz aus negotiorum gestio, verbetener Eigenmacht oder sonstigem schuldhaftem Verhalten. 40 Was — um dies gleich an dieser Stelle zu erörtern — Grabbes Ansprüche auf Schadenersatz anlangt, so ist schwer [GAA, Bd. VI, S. 374] zu sagen, ob sie wirklich völlig ernst genommen sein wollen. Es gibt ja auch jetzt noch Anwälte und auch Laien, die einmal ganz ernsthaft solche Forderungen aufstellen, andererseits aber auch noch übertreiben, um dann sicherer wenig zu 5erhalten, aber mit sich handeln lassen. Grabbes ganze Widerklage hinterläßt so sehr den Eindruck der gewollten Übertreibung, ja an bestimmten Stellen, so z. B. S. sogar den der bewußten Verhöhnung des Gegners, daß man jene Ernsthaftigkeit der Ansprüche wohl nicht durchaus behaupten kann. 10 Die zweite Frage war die, ob Kestners Nachricht an Grabbe Anlaß geben konnte, sich beleidigt zu fühlen. Sie wäre nur dann zu bejahen, wenn — was wir nicht wissen können — Kestner dabei Grabbe als unsicher und das Wohl der Frau gefährdend hingestellt hätte. 15 Im ganzen hat natürlich Kestner recht, wenn er in seiner Replik bemerkt: falls Grabbe in der Meinung gestanden habe, daß ihm Unrecht geschehen sei, so hätte er als Jurist wissen müssen, wo er sein Recht finden könne. In der Tat: wenn Grabbe durch das Zurückhalten des Kastens seine Ehre 20für verletzt, sein Ansehen und einen Kredit für gefährdet hielt, so konnte er Klage erheben, brauchte aber nicht Briefe beleidigenden Inhalts zu schreiben. Hier ist vor allem diejenige Angelegenheit zu besprechen, die den eigentlichen Grund von Kestners Klage bildete: das 25Berühren von Kestners Verhalten in der Sache Wist contra Steffen. Schwerlich liegt hier ein Auftreten als Zeuge in eigener Sache (testis in propria causa) vor. Nachdem ihm der Kaufmann Wist die Geldrolle wieder abgenommen hatte, war doch für den Forstsekretär die Angelegenheit erledigt und er 30an ihrem Ausgange nicht im mindesten mehr interessiert. Daß jemand, der Klage und Eingaben entworfen hat, als Zeuge auftritt, ist nach den heutigen Anschauungen unbedenklich. Damals scheint es ein wenig anders gewesen zu sein. Dies ergibt sich daraus, daß Kestner anfangs selbst Bedenken hatte 35und als Zeuge Wists erst dann aussagte, nachdem der Rat eines anderen Juristen seine Bedenken zerstreut hatte. Bei dieser Sache wäre eigentlich noch festzustellen, ob die zwei 'non's' Grabbes richtig sind oder Kestners gegenteilige Behauptungen. Dazu aber fehlt es an dem erforderlichen Material. 40Unabhängig davon steht es fest, daß Grabbes Handlungsweise, jenes Verhalten Kestners in die neuere Sache hineinzuziehn, [GAA, Bd. VI, S. 375] mit der sie nicht das mindeste zu tun hatte, nicht anständig erscheint, und dies um so weniger, als sie ihm in seiner Eigenschaft als Beamter bekannt geworden und in einem Briefe erwähnt worden war, den er einem unbeteiligten Dritten 5diktiert hatte. Grabbes Verteidigung: der Feldwebel Scharf sei ein ehrenwerter Mann, erscheint dagegen keineswegs stichhaltig. Denn wenn einer ein noch so ehrenwerter Mann ist, so hindert das nicht, daß man ihm gegenüber einen Dritten beleidigen kann. Höchstens das weitere Bekanntwerden der 10Angelegenheit wird durch des Feldwebels Verschwiegenheit — eines der Merkmale der Ehrenhaftigkeit — verhindert. Übrigens hatte Grabbe umso weniger Veranlassung, diese Sache seinem Gegner vorzuwerfen, als er (auf S. 6 der Vernehmlassung) sein Verhalten mit Umständlichkeit und Ängstlichkeit 15erklären will. Im ganzen wird es zur Beantwortung der Frage, ob Kestner sich durch die in Rede stehende Briefstelle beleidigt fühlen konnte, sehr stark auf die Form ankommen, in die Grabbe die Erwähnung der Wist-Steffenschen Sache gebracht hatte. Wenn er dem Gegner dessen Verfahren in 20unnötig scharfer und vielleicht auch „hämischer“ Form vorgeworfen hatte, so wäre sie zu bejahen. Wenn man es, da das „corpus delicti“ fehlt, dahingestellt bleiben lassen muß, ob der dritte Brief Grabbes durch dieses Hereinziehen des Verhaltens Kestners und etwaige sonstige 25„Grobheiten“ auf den Empfänger beleidigend wirken konnte, so ist es ganz außer Frage, daß Grabbe in seiner Vernehmlassung und Widerklage die etwaigen Injurien des Gegners in reichlichem Maße erwidert. Dabei ist indeß immer zu beachten, daß solche, im Prozeß vorgebrachte Dinge niemals tatsächlich 30als Injurien angesehen werden. So ist, wenn Grabbe von dem „angeblich“ verschlossenen Kasten spricht, zu sagen, daß er zweifellos eine solche Wendung als eine Beleidigung angesehen haben würde, wenn sie gegen ihn selbst gebraucht worden wäre. Das gleiche gilt von seinem, 35in Punkt 2 der Widerklage ausgesprochenen Verlangen, die Unversehrtheit des Kastens zu beschwören. Zu der, ja auch in einer Randbemerkung der Klagschrift ausgesprochenen Annahme, der verschlossen abgelieferte Kasten sei bei den Kestners vielleicht geöffnet worden, hatte Grabbe zunächst doch gar 40keine Veranlassung. [GAA, Bd. VI, S. 376] Weiterhin wirft Grabbe Kestner indirekt vor, daß er seine, der Klagschrift als Anlage beigegebenen Briefe nicht getreu abgeschrieben habe. Auch dieses würde er als eine Injurie angesehen haben, wenn es ihm gesagt worden wäre. 5 Nicht anders verhält es sich mit seiner Wendung, daß jeder Candidatus juris, der die Lippische Gütergemeinschaftsverordnung nur flüchtig gelesen habe, einsehen werde, usw. Was endlich das von Grabbe angewandte Gleichnis zwischen der beleidigenden Zurückhaltung des Kastens und dem Schlagen 10anlangt, so kann man wohl nicht anders sagen als daß dieser Vergleich hinke. Denn das Geschlagenwerden erfordert sofortige Abhilfe; mit ruhigem Nachdenken ist da nichts zu machen. Anders bei dem Zurückhalten des Kastens. Dieses war durch eine Einigung mit Louise Christiane, welche Kestner 15anempfiehlt, recht wohl aus der Welt zu schaffen. In der Rückschau auf die Art und Weise, mit der Grabbe sich gegen die ihm nach seiner Überzeugung angetanen Kränkungen zur Wehr setzte, wird man nicht finden, daß die Rolle, die er in diesem Prozesse gespielt hat, die des Überlegenen 20gewesen sei. Man spürt die Wahrheit seines Wortes, daß Mißtrauen ihn lähme. Etwa ein halbes Jahr später nannten die Vorgesetzten ihn einen Mann, der, krank an Leib und Seele, mit sich und der Welt zerfallen sei. Hier verraten sich die ersten Anzeichen dieses Verfalls. 25 Ziegler, dem die zwischen den Parteien gewechselten Briefe offenbar nicht bekannt waren und der von dem Prozesse überhaupt nichts berichtet, spricht dagegen nun noch von einer Duellforderung Grabbes, die Kestner abgelehnt habe. Im Briefe Grabbes vom 4. Juli (die beiden vorhergehenden kommen 30schwerlich in betracht) kann eine solche Aufforderung kaum enthalten gewesen sein, da Kestner sonst im Verlaufe des Prozesses gewiß darauf Bezug genommen hätte. Aus diesem Grunde ist es vielleicht plausibler, anzunehmen, daß sie erst nach Abschluß des Prozesses, vielleicht weil Grabbe durch 35diesen nicht die erhoffte Genugtuung erhielt, erfolgt ist. Alles das sind jedoch müßige Kombinationen, die allzu sehr der sicheren Grundlage entbehren. [GAA, Bd. VI, S. 377] 1.  Klagschrift des Forstsekretärs Kestner gegen den Auditeur Grabbe wegen Beleidigung. pr.[aesentatum] den 7ten Jul. 1833. An Hochfürstliche Justitz Canzley, Klagschrift 5 von Seiten des ForstSecretairs Kestner, Klägers gegen den Auditeur Grabbe, Verklagten, hat Anl. 1 bis 4. puncto injuriarum. 10 Klagschrift des Forstsekretärs Kestner gegen den Auditeur Grabbe wegen Beleidigung. pr.[aesentatum] den 7ten Jul. 1833. An Hochfürstliche Justitz Canzley, Klagschrift 5 von Seiten des ForstSecretairs Kestner, Klägers gegen den Auditeur Grabbe, Verklagten, hat Anl. 1 bis 4. puncto injuriarum. 10  Am 1ten d. M. hatte die Ehegattinn des Verklagten die Meinige ersucht, einen angeblich der Ersteren gehörigen Kasten mit Gelde in Verwahrung zu nehmen. Gerade in dem Augenblicke, als ich von einem Spatziergange zu Hause kam, brachte die Ehegattinn des Verklagten den fraglichen verschlossenen 1 15Kasten in mein Haus und um der mehreren Sicherheit wegen auf meine Arbeitsstube 2. Am 2ten d. M. erhielt ich vom Verklagten das Schreiben Anl. 1, 3 worin derselbe die Herausgabe des Kastens an ihn, sowie die 20Beantwortung verschiedener Fragen begehrt 4. Ich antwortete ihm, daß mir der Kasten allerdings 5, nicht aber andere Sachen anvertraut seyn, daß ich mich aber nicht berechtigt halte, denselben an jemand anders, als die Ehegattinn des Verklagten herauszugeben 6. 25 Am anderen Morgen hatte ich Letztere bereits ersucht, mir den Kasten qu.[aestionis] wieder abzunehmen, und war mir dieses versprochen, als ich das Schreiben Am 1ten d. M. hatte die Ehegattinn des Verklagten die Meinige ersucht, einen angeblich der Ersteren gehörigen Kasten mit Gelde in Verwahrung zu nehmen. Gerade in dem Augenblicke, als ich von einem Spatziergange zu Hause kam, brachte die Ehegattinn des Verklagten den fraglichen verschlossenen 1 15Kasten in mein Haus und um der mehreren Sicherheit wegen auf meine Arbeitsstube 2. Am 2ten d. M. erhielt ich vom Verklagten das Schreiben Anl. 1, 3 worin derselbe die Herausgabe des Kastens an ihn, sowie die 20Beantwortung verschiedener Fragen begehrt 4. Ich antwortete ihm, daß mir der Kasten allerdings 5, nicht aber andere Sachen anvertraut seyn, daß ich mich aber nicht berechtigt halte, denselben an jemand anders, als die Ehegattinn des Verklagten herauszugeben 6. 25 Am anderen Morgen hatte ich Letztere bereits ersucht, mir den Kasten qu.[aestionis] wieder abzunehmen, und war mir dieses versprochen, als ich das Schreiben [GAA, Bd. VI, S. 378] Anlage 2  erhielt 7. Die darin enthaltenen Gründe konnten meine Ansicht, daß ich verpflichtet sey, den Kasten nur der Ehefrau des Verklagten zurück zu geben, nicht ändern 8. Solches geschah 5denn auch noch am nämlichen Tage, wie ich durch die Anlage 3 hiemit bescheinige. Verklagter wurde von der Zurückgabe des Kastens an seine Ehegattin sogleich 9 benachrichtigt, mit dem Bemerken, daß ich nun auch factisch ausser Stande sey, seinem 10Verlangen zu genügen, daß ich übrigens vermuthen müsse, er werde bey ruhigem Nachdenken 10 wohl das beste Mittel, den Kasten wieder ins Haus zu schaffen, finden, daß Nachgiebigkeit gegen billige Forderungen auch dem Manne nicht Schimpf, sondern Ehre bringe u.s.w. 15 Hierauf wurde mir denn das Schreiben vom 4ten d. M. behändigt Anlage 4 Ausser verschiedenen Grobheiten 11, welche jedoch meiner Ehre in den Augen keines vernünftigen Menschen, welcher beyde 20Theile kennt 12, auch nur im Mindesten schaden können erhielt 7. Die darin enthaltenen Gründe konnten meine Ansicht, daß ich verpflichtet sey, den Kasten nur der Ehefrau des Verklagten zurück zu geben, nicht ändern 8. Solches geschah 5denn auch noch am nämlichen Tage, wie ich durch die Anlage 3 hiemit bescheinige. Verklagter wurde von der Zurückgabe des Kastens an seine Ehegattin sogleich 9 benachrichtigt, mit dem Bemerken, daß ich nun auch factisch ausser Stande sey, seinem 10Verlangen zu genügen, daß ich übrigens vermuthen müsse, er werde bey ruhigem Nachdenken 10 wohl das beste Mittel, den Kasten wieder ins Haus zu schaffen, finden, daß Nachgiebigkeit gegen billige Forderungen auch dem Manne nicht Schimpf, sondern Ehre bringe u.s.w. 15 Hierauf wurde mir denn das Schreiben vom 4ten d. M. behändigt Anlage 4 Ausser verschiedenen Grobheiten 11, welche jedoch meiner Ehre in den Augen keines vernünftigen Menschen, welcher beyde 20Theile kennt 12, auch nur im Mindesten schaden können  und die ich daher nicht der Beachtung werth halte, erlaubt sich Verklagter, ohne die geringste von mir gegebene Veranlassung, mir in diesem Schreiben (gleich im Anfange) den Vorwurf zu machen, daß ich in Sachen des Kaufmanns Wist und 25Lieutenant Steffen gegen den Rath Antze erst für Wist geschrieben und nachher, ohne dem Gerichte Anzeige davon zu machen, für ihn als Zeuge aufzutreten gewagt habe. Meine Ehre erlaubt es nicht, daß ich mich bey diesem Vorwurf 30einer Unredlichkeit beruhige. Zu dem Ende erlaube ich mir, das Factum der Wahrheit gemäß vorzutragen. Es handelte sich nämlich um den Defect einer Geldtute im Betrage und die ich daher nicht der Beachtung werth halte, erlaubt sich Verklagter, ohne die geringste von mir gegebene Veranlassung, mir in diesem Schreiben (gleich im Anfange) den Vorwurf zu machen, daß ich in Sachen des Kaufmanns Wist und 25Lieutenant Steffen gegen den Rath Antze erst für Wist geschrieben und nachher, ohne dem Gerichte Anzeige davon zu machen, für ihn als Zeuge aufzutreten gewagt habe. Meine Ehre erlaubt es nicht, daß ich mich bey diesem Vorwurf 30einer Unredlichkeit beruhige. Zu dem Ende erlaube ich mir, das Factum der Wahrheit gemäß vorzutragen. Es handelte sich nämlich um den Defect einer Geldtute im Betrage [GAA, Bd. VI, S. 379] von etwa 9 rthlrn. Diese Tute war vom Hrn. Rath Antze gemacht (wenigstens hatte dieser eigenhändig die Summe darauf bemerkt) und an den Lieutenant Steffen, von diesem an den Kaufmann Wist und von Letzterem an mich ausgegeben. 5Von mir erhielt dieselbe der Kornhändler Austermann, öffnete dieselbe und zählte den Inhalt nach, und zwar in Gegenwart 13 des Ueberbringers, wobey sich denn der Defect gefunden hat.  Die mir zurückgebrachte 14 Tute mit dem darin gefundenen Gelde gab ich an den Kaufmann Wist zurück und erhielt von 10diesem unweigerlich den darauf 15 bemerkten Betrag in anderem Gelde. Der Lieutenant Steffen dagegen weigerte sich, die Tute von Wist zurück zu nehmen und sah sich dieser daher genöthigt, ihn deshalb beym MilitairGericht zu verklagen. Einzig und allein aus dem Grunde, weil mir das Sachverhältniß am 15genauesten bekannt war, erfüllte ich den Wunsch des Kaufmanns Wist, die Klage, sowie auch nachher noch ein Paar andere Eingaben zu entwerfen, ohne daran zu denken, daß der Kläger meines Zeugnisses bedürfen werde. Als dies dennoch 16 nöthig wurde, machte ich mir allerdings selbst ein Bedenken 20daraus, als Zeuge für den Kläger aufzutreten, habe jedoch auf den Rath eines erfahrenen und redlichen Juristen, es nicht für unerlaubt gehalten, meine Wissenschaft 17 von der Sache zu bezeugen, dabey aber allerdings dem Gerichte, — außer dem Verklagten war niemand gegenwärtig 25— davon die Anzeige gemacht 18, daß ich die Schriften des Kaufmanns Die mir zurückgebrachte 14 Tute mit dem darin gefundenen Gelde gab ich an den Kaufmann Wist zurück und erhielt von 10diesem unweigerlich den darauf 15 bemerkten Betrag in anderem Gelde. Der Lieutenant Steffen dagegen weigerte sich, die Tute von Wist zurück zu nehmen und sah sich dieser daher genöthigt, ihn deshalb beym MilitairGericht zu verklagen. Einzig und allein aus dem Grunde, weil mir das Sachverhältniß am 15genauesten bekannt war, erfüllte ich den Wunsch des Kaufmanns Wist, die Klage, sowie auch nachher noch ein Paar andere Eingaben zu entwerfen, ohne daran zu denken, daß der Kläger meines Zeugnisses bedürfen werde. Als dies dennoch 16 nöthig wurde, machte ich mir allerdings selbst ein Bedenken 20daraus, als Zeuge für den Kläger aufzutreten, habe jedoch auf den Rath eines erfahrenen und redlichen Juristen, es nicht für unerlaubt gehalten, meine Wissenschaft 17 von der Sache zu bezeugen, dabey aber allerdings dem Gerichte, — außer dem Verklagten war niemand gegenwärtig 25— davon die Anzeige gemacht 18, daß ich die Schriften des Kaufmanns  Wist concipirt habe. Verklagter fand damals meine Bedenklichkeiten unerheblich 19 und hat dies auch nachher noch gegen den Kaufmann Wist selbst geäußert. Wist concipirt habe. Verklagter fand damals meine Bedenklichkeiten unerheblich 19 und hat dies auch nachher noch gegen den Kaufmann Wist selbst geäußert. [GAA, Bd. VI, S. 380] Ich bemerke hiebey noch, daß ich zwar als Zeuge 20 für meine Versäumniß etwas liquidirte, dies aber so wenig als Bezahlung meiner sonstigen Bemühung späterhin erhalten, oder verlangt habe. Ich war durchaus nicht bey der Sache 5interessirt 21, und glaube deshalb durch meine Deposition in keiner Hinsicht gefehlt zu haben. Seitdem ist wohl ein Jahr verflossen und nun sucht der Verklagte hämischer 22 Weise diesen unbedeutenden Vorfall wieder hervor, um mir daraus mit Entstellung der Wahrheit einen meine Ehre kränkenden 10Vorwurf zu machen. Aus seiner Absicht, mich zu beleidigen, macht Verklagter kein Hehl, wie aus dem Seite 1 unten in der Anl. 4 Gesagten hervorgeht. Diese Beleidigung ist um so größer, weil 15Verklagter den Brief qu. von einem Dritten, dem Feldwebel  Scharf, hat schreiben lassen, solcher auch von ihm dem Secretair Krohn mitgetheilt ist. Hochfürstliche Justitz Canzley bitte ich demnach gehor- samst: den Verklagten zum Widerruf, zur Abbitte und 20 Ehrenerklärung schuldig zu erkennen, auch denselben in die Kosten des Processes zu verurtheilen. Worüber p. Kestner. [Auf der letzten freien Seite:] Scharf, hat schreiben lassen, solcher auch von ihm dem Secretair Krohn mitgetheilt ist. Hochfürstliche Justitz Canzley bitte ich demnach gehor- samst: den Verklagten zum Widerruf, zur Abbitte und 20 Ehrenerklärung schuldig zu erkennen, auch denselben in die Kosten des Processes zu verurtheilen. Worüber p. Kestner. [Auf der letzten freien Seite:]  Ins:[inuatum] am 18n Jul 1833 25 Reuter Hrn. Auditeur Grabbe. 2. Bescheid der Justizkanzlei. Bescheid Diese Klage, ohne die Anlagen, wird dem Verklagten abschriftlich communicirt und, cum partium citatione, Termin 30zur Instruction der Sache auf den 29ten d. M. hierdurch angesetzt. Decr. Detmold den 11ten Juli 1833. Fürstl. Lipp. Justitz Canzley. Rosen. Ins:[inuatum] am 18n Jul 1833 25 Reuter Hrn. Auditeur Grabbe. 2. Bescheid der Justizkanzlei. Bescheid Diese Klage, ohne die Anlagen, wird dem Verklagten abschriftlich communicirt und, cum partium citatione, Termin 30zur Instruction der Sache auf den 29ten d. M. hierdurch angesetzt. Decr. Detmold den 11ten Juli 1833. Fürstl. Lipp. Justitz Canzley. Rosen. [GAA, Bd. VI, S. 381] 3. Protokoll über Grabbes Verteidigung und Widerklage, Kestners Replik und Grabbes Duplik. 23  Actum Detmold den 29sten Jul. 1833 In Gegenwart des Herrn CanzleyRaths Althof. Actum Detmold den 29sten Jul. 1833 In Gegenwart des Herrn CanzleyRaths Althof. | in Sachen | | | | des ForstSecretairs Kestner, | | | | Klägers, . . . . . . | | Erschien in Person und wolle | | contra | | die Vernehmlassung des Verklagten | | den Auditeur Grabbe, Verklagten, | | erwarten. | | | | Auditeur Grabbe erschien e- | | puncto injuriar. | | benfalls und ließ sich auf die |
eingereichte Klage des ForstSecretairs Kestner folgender gestalt vernehmen: Meine Ehefrau, mit der ich in Gütergemeinschaft lebe, hat neulich, wider mein Wissen und wider meinen Willen, einen 15angeblich verschlossenen Kasten mit mehr als 300 rthlrn. Innhalt aus meinem Hause weggebracht. Diesen hat erst die Frau des Klägers und dann der Kläger selbst in Verwahrung genommen, und in zweyen, von mir geschehenen, Anfoderungen de dat. den 2ten und 3ten d. M. ohnerachtet, wider 20 meinen, in eben so ehrenhaft als deutlich erklärten, rechtlich begründeten Willen, zurückbehalten und ihn ex post ohne mein Mitwissen mittelst eines Gesuchs an meine Frau, aus seinem Hause, nach seinem Eingeständnisse, wieder fortgeschafft. 25 Nachdem er auf die oben erwähnten beyden Briefe nicht das Benehmen annahm und die Folge leistete, welche ich, und wohl jeder Jurist für gesetzlich halten müssen und befolgt haben würde, schrieb ich ihm den Brief vom 4ten d. M. Ueber dessen Inhalt fühlt er sich beleidigt. Ich verneine 30aber, daß irgend eine Beleidigung darin enthalten ist und behaupte, daß, selbst wenn jemand solche darin zu entdecken wehnte, meinen, in eben so ehrenhaft als deutlich erklärten, rechtlich begründeten Willen, zurückbehalten und ihn ex post ohne mein Mitwissen mittelst eines Gesuchs an meine Frau, aus seinem Hause, nach seinem Eingeständnisse, wieder fortgeschafft. 25 Nachdem er auf die oben erwähnten beyden Briefe nicht das Benehmen annahm und die Folge leistete, welche ich, und wohl jeder Jurist für gesetzlich halten müssen und befolgt haben würde, schrieb ich ihm den Brief vom 4ten d. M. Ueber dessen Inhalt fühlt er sich beleidigt. Ich verneine 30aber, daß irgend eine Beleidigung darin enthalten ist und behaupte, daß, selbst wenn jemand solche darin zu entdecken wehnte,  diese durch den gerechten Eifer, den Kläger in mir vorgerufen hat, gerechtfertigt wäre; so wie ich auch behaupte, daß alle sonst darin enthaltenen facta auf Wahrheit beruhen, diese durch den gerechten Eifer, den Kläger in mir vorgerufen hat, gerechtfertigt wäre; so wie ich auch behaupte, daß alle sonst darin enthaltenen facta auf Wahrheit beruhen, [GAA, Bd. VI, S. 382] um so mehr, als Kläger dieselben meistentheils in seiner Klagschrift eingesteht. Kläger erhält weder Widerruf, Abbitte, EhrenErklärung, noch KostenErsatz von mir. 5 In specie acceptire ich die confessa in der Klagschrift, insbesondere, daß Klägers Ehefrau den angeblich verschlossenen Kasten in Verwahrung genommen und er, Kläger, ihn nachher doch mehrere Tage wider meinen Willen zurückgehalten hat, nämlich, wie schon aus Anl. 1 und 2 der Klagschrift nach 10den Geständnissen des Gegners hervorgehen wird, wenigstens vom 1sten bis zum 3ten d. M.  2)daß Kläger 2 Briefe, jetzt Anl. 1 u. 2 seiner Klagschrift, von mir erhalten hat, worin er wiederholt rechtlich ersucht ist, mir den Kasten zurückzugeben und er 153)solches doch nach Empfang des 2ten Briefs nicht gethan hat, worüber ich sein Eingeständniß annehme; wobey ich bemerke, daß ich die Anl. 1 u. 2 der Klagschrift, welche die Copien oder Originalien der beyden Schreiben, worüber der Gegner sich nicht näher ausdrückt, enthalten müssen, 20anzusehen wünsche, indem ich selbige sonst und wenn sie nicht mit dem Originale mir zu harmoniren scheinen, in meinen Concepten vorlegen und damit vergleichen lassen werde. 4.)Acceptire ich ebenfalls utilissime, daß der Gegner, nachdem 25er meinen ersten Brief erhalten, statt diesen, wie er mußte, 2)daß Kläger 2 Briefe, jetzt Anl. 1 u. 2 seiner Klagschrift, von mir erhalten hat, worin er wiederholt rechtlich ersucht ist, mir den Kasten zurückzugeben und er 153)solches doch nach Empfang des 2ten Briefs nicht gethan hat, worüber ich sein Eingeständniß annehme; wobey ich bemerke, daß ich die Anl. 1 u. 2 der Klagschrift, welche die Copien oder Originalien der beyden Schreiben, worüber der Gegner sich nicht näher ausdrückt, enthalten müssen, 20anzusehen wünsche, indem ich selbige sonst und wenn sie nicht mit dem Originale mir zu harmoniren scheinen, in meinen Concepten vorlegen und damit vergleichen lassen werde. 4.)Acceptire ich ebenfalls utilissime, daß der Gegner, nachdem 25er meinen ersten Brief erhalten, statt diesen, wie er mußte,  zu befolgen, selbst bey meiner Frau hinter meinem Rücken und ohne mein Wissen nachgesucht hat, ihm den Kasten qu. wieder abzunehmen. Dadurch ist er freilich, wie er sagt, nachher „factisch“ vielleicht ausser Stande 30gewesen, meinem ihm längst geäußerten Verlangen zu genügen. Jeder Candidatus juris, der unsere GütergemeinschaftsVerordnung nur flüchtig gelesen hat, insbesondere die Einleitung, die §. §. 1. 8 u. 9 etc. derselben kennt und welche ich vor diesem hohen Gericht wohl nicht wörtlich 35anzuführen brauche, wird einsehen, daß Kläger weder die Rechte in Erwägung gezogen hat, als daß er auch nicht umsichtig und nicht gesetzlich handelte, indem er mit meiner Umgehung offenbar nur des Kastens los zu werden gesucht und meine Schreiben nicht zu befolgen, selbst bey meiner Frau hinter meinem Rücken und ohne mein Wissen nachgesucht hat, ihm den Kasten qu. wieder abzunehmen. Dadurch ist er freilich, wie er sagt, nachher „factisch“ vielleicht ausser Stande 30gewesen, meinem ihm längst geäußerten Verlangen zu genügen. Jeder Candidatus juris, der unsere GütergemeinschaftsVerordnung nur flüchtig gelesen hat, insbesondere die Einleitung, die §. §. 1. 8 u. 9 etc. derselben kennt und welche ich vor diesem hohen Gericht wohl nicht wörtlich 35anzuführen brauche, wird einsehen, daß Kläger weder die Rechte in Erwägung gezogen hat, als daß er auch nicht umsichtig und nicht gesetzlich handelte, indem er mit meiner Umgehung offenbar nur des Kastens los zu werden gesucht und meine Schreiben nicht  berücksichtigt hat. 405)Acceptire ich ebenfalls, daß der Gegner eingesteht, einstmals in Sachen des Kaufmanns Wist und Pr. Lieutenant berücksichtigt hat. 405)Acceptire ich ebenfalls, daß der Gegner eingesteht, einstmals in Sachen des Kaufmanns Wist und Pr. Lieutenant [GAA, Bd. VI, S. 383] Steffen contra Rath Antze erst für den Kaufmann Wist die Klage, nachher auch ein paar andere Eingaben entworfen zu haben, sich auch factisch daraus kein Bedenken gemacht, als Zeuge für die Klägerische Seite aufzutreten, 5jedoch sich nicht selbst scheint befragt zu haben, was er recht gut thun konnte, indem er denn doch schon lange selbst ein erfahrner und wie ich in vollem Ernst glaube, ein redlich meinender Jurist ist, sondern erst den „Rath eines andern und erfahrnen Juristen“ eingezogen hat. 10Nur wird hierbey bemerkt, daß Kläger nicht früher, sondern nachdem er beeydigt war und seine Aussage zu Protocoll deponirt hatte,  schriftlich und mündlich angab, er habe früher für den Kaufmann Wist gearbeitet. Dazu füge ich, daß ich selbst den Gegner für einen sehr rechtschaffenen 15Mann halte, indeß daß es mir scheint, daß er sowohl damals als jetzt zu umständlich und zu ängstlich gehandelt habe. Auch war mir das Zurückhalten des Kastens und das Wiederabgeben desselben, während welcher Zeit er mir 20ruhiges Nachdenken empfahl /: welches nach der Anomalie so angenommen werden kann, als wenn man jemand recht durchhaut und ihm während des Durchhauens empfiehlt, so lange zu warten, bis er durchgehauen ist :/ an sich so unangenehm und widerrechtlich, daß ich nicht „hämischer 25 Weise“ sondern um ihn durch ein anderes Beyspiel auf sein mich schriftlich und mündlich angab, er habe früher für den Kaufmann Wist gearbeitet. Dazu füge ich, daß ich selbst den Gegner für einen sehr rechtschaffenen 15Mann halte, indeß daß es mir scheint, daß er sowohl damals als jetzt zu umständlich und zu ängstlich gehandelt habe. Auch war mir das Zurückhalten des Kastens und das Wiederabgeben desselben, während welcher Zeit er mir 20ruhiges Nachdenken empfahl /: welches nach der Anomalie so angenommen werden kann, als wenn man jemand recht durchhaut und ihm während des Durchhauens empfiehlt, so lange zu warten, bis er durchgehauen ist :/ an sich so unangenehm und widerrechtlich, daß ich nicht „hämischer 25 Weise“ sondern um ihn durch ein anderes Beyspiel auf sein mich  verletzendes und widergeseztliches Benehmen aufmerksam zu machen, an die Sache gegen Antze erinnerte. Sodann verneine ich, ihn auf irgend eine Weise beleidigt zu haben, indem meine Briefe vom 2. und 3. d. M., wie 30jeder Leser erkennen wird, wenigstens ganz ehrenhaft waren, und nachdem diese Briefe vom Gegner in Sach und That unbeachtet gelassen worden, der Brief vom 4ten d. M. nebst dessen Nachschrift, zu dem ich mich nur nothgedrungen entschloß, durchaus unvermeidlich war, Falls 35ich nicht Klägern gerichtlich belangen oder den unter dessen Administration stehenden Kasten nebst dessen Inhalt realiter unter Aufsicht der Behörden von ihm oder jedem andern, der ihn unmittelbar oder mittelbar von dem verletzendes und widergeseztliches Benehmen aufmerksam zu machen, an die Sache gegen Antze erinnerte. Sodann verneine ich, ihn auf irgend eine Weise beleidigt zu haben, indem meine Briefe vom 2. und 3. d. M., wie 30jeder Leser erkennen wird, wenigstens ganz ehrenhaft waren, und nachdem diese Briefe vom Gegner in Sach und That unbeachtet gelassen worden, der Brief vom 4ten d. M. nebst dessen Nachschrift, zu dem ich mich nur nothgedrungen entschloß, durchaus unvermeidlich war, Falls 35ich nicht Klägern gerichtlich belangen oder den unter dessen Administration stehenden Kasten nebst dessen Inhalt realiter unter Aufsicht der Behörden von ihm oder jedem andern, der ihn unmittelbar oder mittelbar von dem  Klä- ger weiter erhalten, ins Haus schaffen wollte. 40 Darin, daß der Feldwebel Scharf den Brief vom 4ten d. M. schrieb, sehe ich keine Beleidigung, indem der Feldwebel Klä- ger weiter erhalten, ins Haus schaffen wollte. 40 Darin, daß der Feldwebel Scharf den Brief vom 4ten d. M. schrieb, sehe ich keine Beleidigung, indem der Feldwebel [GAA, Bd. VI, S. 384] Scharf, so viel ich weiß, ein eben so ehrenwerther Mann wie der Gegner und ich ist und ich überdem grade durch das nicht zu entschuldigende Benehmen des Gegners in solche gerechte Verdrießlichkeit gerieth, daß ich zu jener 5Zeit krank geworden war und weder in dieser noch in andern Sachen selbst schreiben [konnte], sondern dictiren mußte. Wie wenig der Gegner zu fürchten hat, daß mit dem Kasten durch mich irgend etwas ihm entfernt schaden 10könnendes geschehen wäre, mag er daraus abnehmen, daß, als /: freilich durch eine andere Vermittelung, als die Seinige :/ der Kasten  neulich ohne Hülfe des Gerichts in mein Haus zurückgeliefert wurde, ich ihm meiner Frau zur Ablieferung an die Witwen-Casse hinsichtlich der unter 15andern darin befindlichen 300 rthlr. aber freilich auch keines weiter darin befindlichen Groschens sofort überließ und habe ich den Kasten bis jetzt nicht angefaßt, sondern es verwahrt ihn meine Frau. Schließlich bemerke ich, daß ich durchaus nicht in meinem 20Schreiben vom 4. d. M. die in der Klagschrift speciell angegebenen Injurien finden kann, wenn ich gesagt: „daß das ganze Deutschland mich besser kennte und höher schätzte, als Sie geschätzt werden“, so entstand diese Aeußerung dadurch, daß Kläger, der mein Eigenthum 25zurückgehalten, mir ruhiges Nachdenken und anderes dergl. empfahl, neulich ohne Hülfe des Gerichts in mein Haus zurückgeliefert wurde, ich ihm meiner Frau zur Ablieferung an die Witwen-Casse hinsichtlich der unter 15andern darin befindlichen 300 rthlr. aber freilich auch keines weiter darin befindlichen Groschens sofort überließ und habe ich den Kasten bis jetzt nicht angefaßt, sondern es verwahrt ihn meine Frau. Schließlich bemerke ich, daß ich durchaus nicht in meinem 20Schreiben vom 4. d. M. die in der Klagschrift speciell angegebenen Injurien finden kann, wenn ich gesagt: „daß das ganze Deutschland mich besser kennte und höher schätzte, als Sie geschätzt werden“, so entstand diese Aeußerung dadurch, daß Kläger, der mein Eigenthum 25zurückgehalten, mir ruhiges Nachdenken und anderes dergl. empfahl,  und ist damit nicht gesagt, daß Kläger nicht ebenso geistreich oder geistreicher als ich sey, sondern daß Deutschland mich öffentlich besser kenne, wie ich ihm auch das rechtlichen Falls beweisen kann. Auch hat er diesen 30Passus in seiner Klagschrift auf p. 3. unten, wo er von beyden Theilen spricht und so ohngefähr glaubt, jeder vernünftige Mensch müsse ihm Recht geben, genugsam erwiedert, wobei ich bemerke, daß schon der Inhalt dieses Passus mich verletzt. 35 Auch dem ConsistorialSecretair Krohn habe ich die Briefe qu. nicht vorgelesen, um Gegner zu beleidigen, sondern ich bat ihn, wider den Gegner den Proceß zu übernehmen, welchen ich selbst nicht anfangen wolle; indem ich in eigenen ProceßSachen nicht gern selbst arbeite, oder den 40Kasten mir zurückzuschaffen und und ist damit nicht gesagt, daß Kläger nicht ebenso geistreich oder geistreicher als ich sey, sondern daß Deutschland mich öffentlich besser kenne, wie ich ihm auch das rechtlichen Falls beweisen kann. Auch hat er diesen 30Passus in seiner Klagschrift auf p. 3. unten, wo er von beyden Theilen spricht und so ohngefähr glaubt, jeder vernünftige Mensch müsse ihm Recht geben, genugsam erwiedert, wobei ich bemerke, daß schon der Inhalt dieses Passus mich verletzt. 35 Auch dem ConsistorialSecretair Krohn habe ich die Briefe qu. nicht vorgelesen, um Gegner zu beleidigen, sondern ich bat ihn, wider den Gegner den Proceß zu übernehmen, welchen ich selbst nicht anfangen wolle; indem ich in eigenen ProceßSachen nicht gern selbst arbeite, oder den 40Kasten mir zurückzuschaffen und  mußte er daher aus den Briefen qu. instruirt werden. mußte er daher aus den Briefen qu. instruirt werden. [GAA, Bd. VI, S. 385] Ersteres that er nicht gern, weil der Gegner sein Procurator und Bekannter ist, letzteres versuchte er, jedoch vergebens. Auch die Originalien der mir zugeschickten Briefe des 5Gegners vom 2ten und 3ten Jul. d. J., welche meine Angaben bestätigen, kann ich auf Erfodern diesem verehrlichen Gerichte mittheilen. Nun stelle ich aber folgende Wiederklage an, die ich, da ich schon längst entschlossen war, den Kläger gerichtlich 10zu belangen, deshalb um so mehr zu Protocoll gebe, 1.)der Kläger hat dadurch, daß er wissentlich [einen] aus einem wohlhabenden Haushalt wider Wissen des Mannes durch seine, Klägers Frau, angenommenen Kasten, dessen Inhalt er angeblich nicht kennen wollte, von dem er aber 15wußte, daß er über 300 rthlr. Geld  enthielt, wieder angenommen, bewahrt und zurückgehalten hat, äußerst gesetzwidrig, um mich mild auszudrücken, gehandelt, und verlange ich, da er, soviel ich weiß, noch nicht zum General -Depositar des ganzen Landes oder zum SpecialDepositar 20für die aus einer Gemeinschaft weggebrachte Sachen angesetzt ist, eine wegen dieses Verfahrens vom Gerichte anzusetzende paßliche Strafe. 2)Verlange ich, daß er und seine Frau, die den angeblich verschlossenen Geld Kasten verwahrt, zurückgehalten und 25wie sie sagen, abgeliefert haben und zwar, alles gegen meinen dem Kläger bekannten Willen, vor Hochfürstl. Justitz-Canzley eydlich erhärten, daß während der Zeit, wo sie den Kasten in Händen gehabt, so wie auch während der Zeit, enthielt, wieder angenommen, bewahrt und zurückgehalten hat, äußerst gesetzwidrig, um mich mild auszudrücken, gehandelt, und verlange ich, da er, soviel ich weiß, noch nicht zum General -Depositar des ganzen Landes oder zum SpecialDepositar 20für die aus einer Gemeinschaft weggebrachte Sachen angesetzt ist, eine wegen dieses Verfahrens vom Gerichte anzusetzende paßliche Strafe. 2)Verlange ich, daß er und seine Frau, die den angeblich verschlossenen Geld Kasten verwahrt, zurückgehalten und 25wie sie sagen, abgeliefert haben und zwar, alles gegen meinen dem Kläger bekannten Willen, vor Hochfürstl. Justitz-Canzley eydlich erhärten, daß während der Zeit, wo sie den Kasten in Händen gehabt, so wie auch während der Zeit,  wo er durch ihre Schuld in anderen Händen als 30den meinigen gewesen, er durchaus so geblieben ist, wie sie und die dritten Personen ihn empfangen haben, wobei ich aber das Datum und das Wesen des Empfangs von dem Tage an rechne, an welchem meine Frau den Kasten weggebracht hat. 353)Hat der Kläger dadurch, daß er wider die Gütergemeinschafts -Verordnung, das mir und meiner Frau gehörige, aber auch unter meiner Administration stehende, Eigenthum zurückbehielt, ein Vergehen begangen, welches ich mit keinem andern als mit dem crimen vis vergleichen kann und 40bitte ich, ihn dieserhalb civiliter angemessen zu bestrafen, wo er durch ihre Schuld in anderen Händen als 30den meinigen gewesen, er durchaus so geblieben ist, wie sie und die dritten Personen ihn empfangen haben, wobei ich aber das Datum und das Wesen des Empfangs von dem Tage an rechne, an welchem meine Frau den Kasten weggebracht hat. 353)Hat der Kläger dadurch, daß er wider die Gütergemeinschafts -Verordnung, das mir und meiner Frau gehörige, aber auch unter meiner Administration stehende, Eigenthum zurückbehielt, ein Vergehen begangen, welches ich mit keinem andern als mit dem crimen vis vergleichen kann und 40bitte ich, ihn dieserhalb civiliter angemessen zu bestrafen, [GAA, Bd. VI, S. 386] oder sonst wegen dieses Punktes die Sache ans Criminal-Gericht abzuliefern. Auch beziehe ich mich wegen dieses gegnerischen Verfahrens unter andern  noch auf 5 1. 1. §. 1. D. de inj. 1. 1. D. de neg. gest. 1. 3. D. quod met. caus. pp. 4)Wieder verklage ich daher mit Recht den Gegner ferner wegen Injurien, indem er dadurch, daß er sich in meine 10VermögensVerhältnisse zwischen mir und meiner Ehefrau mischte, mich für einen so ehrlosen oder verächtlichen Ehemann gehalten hat, der nicht einmal einen aus seinem Hause verschleppten Kasten wieder fodern kann, mich äußerst beleidigt hat. 15 Dieses ist unbedingt eine Injurie conf. z. B. Quistorp Grundsätze des peinl. Rechts 4. Ausg. §. 13 [irrtümlich statt 305] Z. 8—1 dess. und solche Wiederklage stelle ich um so mehr an, als in einer kleinen Stadt wie Detmold, wo Jedermann, insbesondere 20auch der noch auf 5 1. 1. §. 1. D. de inj. 1. 1. D. de neg. gest. 1. 3. D. quod met. caus. pp. 4)Wieder verklage ich daher mit Recht den Gegner ferner wegen Injurien, indem er dadurch, daß er sich in meine 10VermögensVerhältnisse zwischen mir und meiner Ehefrau mischte, mich für einen so ehrlosen oder verächtlichen Ehemann gehalten hat, der nicht einmal einen aus seinem Hause verschleppten Kasten wieder fodern kann, mich äußerst beleidigt hat. 15 Dieses ist unbedingt eine Injurie conf. z. B. Quistorp Grundsätze des peinl. Rechts 4. Ausg. §. 13 [irrtümlich statt 305] Z. 8—1 dess. und solche Wiederklage stelle ich um so mehr an, als in einer kleinen Stadt wie Detmold, wo Jedermann, insbesondere 20auch der  Gegner, die Grundsätze der GütergemeinschaftsVerordnung kennen muß, eben durch die Weigerung des Gegners, den Kasten zurückzuliefern, die Sache Gegenstand eines scandalösen Gesprächs geworden ist. Wer kleine Städte kennt, wird dies zu beurtheilen wissen 25und mögte ich wagen, Jedem Mitgliede dieses Gerichts die Frage vorzulegen: ob es in einem Fall, wie ihn der Gegner bey mir bewirkt hat, nicht in einen gerechten Eifer gekommen wäre? 5.)Für dieses allgemeine injuriöse Benehmen, in specie so weit 30es sich aus voriger nr. 4 ergiebt und dafür, daß Kläger mich durch Zurückhaltung des Kastens in Miß-Kredit gebracht hat, welcher immer, da mein und meiner Frau Gesammt-Vermögen sich auf 12000 rthlr. beläuft, ebenso hoch als dieses anzuschlagen ist, Gegner, die Grundsätze der GütergemeinschaftsVerordnung kennen muß, eben durch die Weigerung des Gegners, den Kasten zurückzuliefern, die Sache Gegenstand eines scandalösen Gesprächs geworden ist. Wer kleine Städte kennt, wird dies zu beurtheilen wissen 25und mögte ich wagen, Jedem Mitgliede dieses Gerichts die Frage vorzulegen: ob es in einem Fall, wie ihn der Gegner bey mir bewirkt hat, nicht in einen gerechten Eifer gekommen wäre? 5.)Für dieses allgemeine injuriöse Benehmen, in specie so weit 30es sich aus voriger nr. 4 ergiebt und dafür, daß Kläger mich durch Zurückhaltung des Kastens in Miß-Kredit gebracht hat, welcher immer, da mein und meiner Frau Gesammt-Vermögen sich auf 12000 rthlr. beläuft, ebenso hoch als dieses anzuschlagen ist,  fodere ich nun sowohl 35wegen meiner Ehre als meines Credits auf rechtlichem Wege Genugthuung. Meine Ehre und mein Credit sind mir unschätzbar und ich dürfte füglich das ganze Activ-Vermögen und die Hälfte seines Gehalts, so lange er und seine Erben existiren und so lange ich und meine 40Erben leben, nach den Gesetzen der actio aest.[imatoria] für mich in Anspruch nehmen; jedoch verzichte ich hierauf fodere ich nun sowohl 35wegen meiner Ehre als meines Credits auf rechtlichem Wege Genugthuung. Meine Ehre und mein Credit sind mir unschätzbar und ich dürfte füglich das ganze Activ-Vermögen und die Hälfte seines Gehalts, so lange er und seine Erben existiren und so lange ich und meine 40Erben leben, nach den Gesetzen der actio aest.[imatoria] für mich in Anspruch nehmen; jedoch verzichte ich hierauf [GAA, Bd. VI, S. 387] und verlange nur, da ich unmöglich diese Sache leicht nehmen kann, oder leicht nehmen darf, den Kläger anzuhalten, mir a) alle Kosten zu erstatten, 5 b) 300 Rthlr. /: über welche Summe noch hinaus in den Kasten an Gelde befindlich gewesen ist :/ an irgend eine Waisen- oder sonstige wohlthätige öffentliche Anstalt in unserm Lande auszuzahlen. Zugleich überlasse ich 106)die mir in seiner Klagschrift vorgehaltenen, von mir begangen  seyn sollenden Grobheiten und die mir ebenfalls daselbst circa finem vorgehaltene „hämische Weise“ diesem hohen Obergerichte zur Prüfung und Verfügung. Kläger repl. Er acceptire die in dem Vortrage des Verklagten 15enthaltenen confessa. Beziehe sich statt weiterer Antwort auf das größtentheils nicht zur Sache gehörige gegenseitige Vorbringen, auf den Inhalt der Klage und wolle nur contrad.[icenti] contrad.[icens] bemerken, daß die in Frage stehende Injurie auf keine Weise gerechtfertigt 20werden könne, zumal Verklagter, Falls er in der Meinung gestanden, daß ihm unrecht geschehen, als Jurist habe wissen müssen, wo er sein Recht finden könne. Er wiederhole lediglich den in seiner Klagschrift gestellten Antrag. 25 Was die angestellten Wiederklagen betreffe, so müsse seyn sollenden Grobheiten und die mir ebenfalls daselbst circa finem vorgehaltene „hämische Weise“ diesem hohen Obergerichte zur Prüfung und Verfügung. Kläger repl. Er acceptire die in dem Vortrage des Verklagten 15enthaltenen confessa. Beziehe sich statt weiterer Antwort auf das größtentheils nicht zur Sache gehörige gegenseitige Vorbringen, auf den Inhalt der Klage und wolle nur contrad.[icenti] contrad.[icens] bemerken, daß die in Frage stehende Injurie auf keine Weise gerechtfertigt 20werden könne, zumal Verklagter, Falls er in der Meinung gestanden, daß ihm unrecht geschehen, als Jurist habe wissen müssen, wo er sein Recht finden könne. Er wiederhole lediglich den in seiner Klagschrift gestellten Antrag. 25 Was die angestellten Wiederklagen betreffe, so müsse  er sich vorbehalten, darauf schriftlich zu antworten, wozu um eine OrdnungsFrist gebeten werde; ref. exp. Verklagter dupl. Daß Kläger confessa acceptire, begreife er nicht, indem 30weder gar keine da seyn, oder keine, die ihm nützen könne. Daß er behaupte, es sey keine Injurie oder gesetzwidriges Benehmen vorhanden, sey unbegreiflich, indem solche gesetzwidrige Handlungen, es mögen Injurien, Mord, Raub, 35Gewaltthätigkeiten seyn, schon an sich strafbar wären und nicht erst dadurch strafbar würden, daß man sie bey Gericht denunciirte. In gegenwärtigen Falle habe aber Kläger, wenn man auf diesen sonderbaren Einwurf Rücksicht nehmen wollte, dadurch, daß er den Kasten schon 40binnen 3 Tagen wieder fortgeschafft habe /: vielleicht eben aus einer Furcht vor einer Klage :/ er sich vorbehalten, darauf schriftlich zu antworten, wozu um eine OrdnungsFrist gebeten werde; ref. exp. Verklagter dupl. Daß Kläger confessa acceptire, begreife er nicht, indem 30weder gar keine da seyn, oder keine, die ihm nützen könne. Daß er behaupte, es sey keine Injurie oder gesetzwidriges Benehmen vorhanden, sey unbegreiflich, indem solche gesetzwidrige Handlungen, es mögen Injurien, Mord, Raub, 35Gewaltthätigkeiten seyn, schon an sich strafbar wären und nicht erst dadurch strafbar würden, daß man sie bey Gericht denunciirte. In gegenwärtigen Falle habe aber Kläger, wenn man auf diesen sonderbaren Einwurf Rücksicht nehmen wollte, dadurch, daß er den Kasten schon 40binnen 3 Tagen wieder fortgeschafft habe /: vielleicht eben aus einer Furcht vor einer Klage :/  dem Verklagten dem Verklagten [GAA, Bd. VI, S. 388] die Zeit genommen, ihn da, wo es jetzt geschieht und wo es sich gebührte, zeitlich zu belangen. Dagegen-, daß Klägern die Wiederklage abschriftlich mitgetheilt würde, hätte Verklagter nichts zu erinnern, 5jedoch wäre derselbe bereit gewesen, deshalb sofort auf die Vernehmlassung des Klägers zu repliciren und bitte er gehorsamst, daß die abschriftliche Mittheilung dieser Wiederklage, indem Gegner sie in diesem angesetzten Termine nicht beantwortet hat, durchaus auf seine Kosten 10geschehe. Der gleich zu Anfang des heutigen Termins von Gerichtswegen gemachte Versuch einer gütlichen Beylegung der Sache blieb ohne Erfolg. a.[ctum] u.[t] s.[upra] 15 fidem 4. Gesuch des Forstsekretärs Kestner. 24  | | pr. den 12. Sept. 1833. | | | | An | | ForstSecretair Kestner, | | Hochfürstl. Justitz Canzley | | Kläger | | | | gegen | | | | den Auditeur Grabbe, | | | | Verkl. | | | | p. injur. | | |
25 Da ich auf die gegen mich an- gestellte Reconvention in termino den 29. Jul. c. wegen Kürze der Zeit nicht antworten konnte, nachher aber durch eine Reise und durch andere Geschäfte daran verhindert worden bin, so bitte 30ich gehorsamst: auf gedachtes Protocoll nicht schon aus morgen statt findender Session zu decretiren, sondern mir dasselbe zur Einsicht  br.[evi]) m.[anu] hochgeneigtest in orig. zu communiciren. 35 p. Kestner. br.[evi]) m.[anu] hochgeneigtest in orig. zu communiciren. 35 p. Kestner. [GAA, Bd. VI, S. 389] 5. Bescheid der Justizkanzlei. Bescheid Die gebetene Mittheilung der Acten an den Kläger, und zwar auf 3 Tage, wird bewilligt. Decr. Detmold d. 12. Septbr. 1833. 5 Fürstl. Lipp. Justiz-Canzley. 6. Entgegnung des Forstsekretärs Kestner auf Grabbes Widerklage. 25  pr. d. 17. Sept. 1833. An Hochfürstl. Justitz Canzley, Vernehmlassung 10 von Seiten des ForstSecretairs Kestner, Klägers und Wiederverklagten gegen den Auditeur Grabbe, Verklagten und 15 Wiederkläger, injur. pr. d. 17. Sept. 1833. An Hochfürstl. Justitz Canzley, Vernehmlassung 10 von Seiten des ForstSecretairs Kestner, Klägers und Wiederverklagten gegen den Auditeur Grabbe, Verklagten und 15 Wiederkläger, injur.  Es möchte fast überflüssig scheinen, auf die vom Herrn Gegner gegen mich angestellte Wiederklage das Geringste zu erwidern, denn von seinen 5 Anträgen ist der eine wirklich so grundlos, ja man kann sagen absurd, wie der andere. 20 Die Ehegattinn des Verklagten ist nicht blos mir, sondern dem ganzen hiesigen Publico als ein im höchsten Grade redliches und achtungswerthes Frauenzimmer bekannt. Als dieselbe am 1. Jul. d. J., ohne mich vorher deshalb zu befragen, einen verschlossenen Kasten mit Gelde mir zur Verwahrung 25anvertraute, mit der Eröffnung, daß sie zwar mit ihrem Ehemann in Gütergemeinschaft lebe, derselbe ihr jedoch die Verwaltung des von ihr inferirten Vermögens zu belassen versprochen habe, daß das Geld ihr gehöre, daß dasselbe zum Einsatz in eine Witwen-Casse bestimmt und bisher dazu aufbewahrt 30sey, der Verklagte jedoch nun gegen ihren Willen in andere Art darüber disponiren wolle; so fehlte es mir durchaus Es möchte fast überflüssig scheinen, auf die vom Herrn Gegner gegen mich angestellte Wiederklage das Geringste zu erwidern, denn von seinen 5 Anträgen ist der eine wirklich so grundlos, ja man kann sagen absurd, wie der andere. 20 Die Ehegattinn des Verklagten ist nicht blos mir, sondern dem ganzen hiesigen Publico als ein im höchsten Grade redliches und achtungswerthes Frauenzimmer bekannt. Als dieselbe am 1. Jul. d. J., ohne mich vorher deshalb zu befragen, einen verschlossenen Kasten mit Gelde mir zur Verwahrung 25anvertraute, mit der Eröffnung, daß sie zwar mit ihrem Ehemann in Gütergemeinschaft lebe, derselbe ihr jedoch die Verwaltung des von ihr inferirten Vermögens zu belassen versprochen habe, daß das Geld ihr gehöre, daß dasselbe zum Einsatz in eine Witwen-Casse bestimmt und bisher dazu aufbewahrt 30sey, der Verklagte jedoch nun gegen ihren Willen in andere Art darüber disponiren wolle; so fehlte es mir durchaus [GAA, Bd. VI, S. 390] an allem Grunde, die Wahrheit dieser  Angaben zu bezweifeln und würde ich mich gegen die Ehegattinn des Verklagten, eine langjährige Freundinn der meinigen, äußerst ungefällig bezeigt haben, wenn ich die Annahme des qu. 5Kastens hätte verweigern wollen. Ich stelle durchaus in Abrede, dadurch dem Verklagten Unrecht gethan zu haben. Dies geschah auch so wenig durch meine Weigerung, den qu. Kasten an den Verklagten herauszugeben, als durch die WiederAblieferung jenes an die Ehegattinn 10des Verklagten. Ich habe ihm, dem Verklagten, dadurch keinen Schaden zugefügt, weder an seinem Vermögen, noch an seiner Ehre. Derselbe weiß dies auch recht wohl. Seine ganze Intention ist einzig und allein die, durch seine höchst lächerliche Widerklage die Aufmerksamkeit von der gegen 15ihn angestellten Klage abzuleiten. Was insbesondere das Verlangen des Verklagten betrifft, daß nicht blos ich, sondern auch meine Frau beschwören Angaben zu bezweifeln und würde ich mich gegen die Ehegattinn des Verklagten, eine langjährige Freundinn der meinigen, äußerst ungefällig bezeigt haben, wenn ich die Annahme des qu. 5Kastens hätte verweigern wollen. Ich stelle durchaus in Abrede, dadurch dem Verklagten Unrecht gethan zu haben. Dies geschah auch so wenig durch meine Weigerung, den qu. Kasten an den Verklagten herauszugeben, als durch die WiederAblieferung jenes an die Ehegattinn 10des Verklagten. Ich habe ihm, dem Verklagten, dadurch keinen Schaden zugefügt, weder an seinem Vermögen, noch an seiner Ehre. Derselbe weiß dies auch recht wohl. Seine ganze Intention ist einzig und allein die, durch seine höchst lächerliche Widerklage die Aufmerksamkeit von der gegen 15ihn angestellten Klage abzuleiten. Was insbesondere das Verlangen des Verklagten betrifft, daß nicht blos ich, sondern auch meine Frau beschwören  sollen, daß aus dem Kasten nichts herausgekommen sey, so ist dies um so mehr eine neue Beleidigung, weil, wie Anlage 3 der 20Klage beweist, und dem Verklagten auch bekannt ist, der quaest. Kasten mir verschlossen übergeben und verschlossen zurück geliefert ist. Meine Frau hat ihn keinen Augenblick in Verwahrung gehabt. Die grundlosen Anträge der Widerklage glaube ich, ohne 25darüber weiter ein Wort zu verlieren, der Würdigung dieses hohen Obergerichts ruhig anheimstellen zu können und bitte gehorsamst: den Widerkläger, unter Verurtheilung in die verursachten Kosten, damit ab- und zur Ruhe 30 zu verweisen. sollen, daß aus dem Kasten nichts herausgekommen sey, so ist dies um so mehr eine neue Beleidigung, weil, wie Anlage 3 der 20Klage beweist, und dem Verklagten auch bekannt ist, der quaest. Kasten mir verschlossen übergeben und verschlossen zurück geliefert ist. Meine Frau hat ihn keinen Augenblick in Verwahrung gehabt. Die grundlosen Anträge der Widerklage glaube ich, ohne 25darüber weiter ein Wort zu verlieren, der Würdigung dieses hohen Obergerichts ruhig anheimstellen zu können und bitte gehorsamst: den Widerkläger, unter Verurtheilung in die verursachten Kosten, damit ab- und zur Ruhe 30 zu verweisen. Worüber p. Kestner. 7. Bescheid der Justizkanzlei. Bescheid Worüber p. Kestner. 7. Bescheid der Justizkanzlei. Bescheid  Communicetur dem Wiederkläger ad replicandum in termino 35ordinis. Übrigens wird, und zwar vorerst auf gemeinschaftliche Kosten, das Protocoll ]7[ act. beyden Theilen, der Nachtrag des Wiederklägers dazu, ]8[ act., dem Wiederverklagten, sowie Communicetur dem Wiederkläger ad replicandum in termino 35ordinis. Übrigens wird, und zwar vorerst auf gemeinschaftliche Kosten, das Protocoll ]7[ act. beyden Theilen, der Nachtrag des Wiederklägers dazu, ]8[ act., dem Wiederverklagten, sowie [GAA, Bd. VI, S. 391] dessen Eingabe nebst aufgeschriebenem Decrete, ]9[ act., dem Wiederkläger abschriftlich zur Nachricht mitgetheilt. Decr. Detmold den 19ten Septbr 1833. Fürstl. Lipp. Justitz-Canzley. 5 Ballhorn Rosen. [Auf der letzten freien Seite:]  Ins: am 30ten Sept. 1833 Reuter Hrn: Auditeur Grabbe. 8. Anfrage Grabbes bei Syndikus Runnenberg. 10G. P. Wollen Sie wohl in dieser Sache mein Procurator seyn? Und beim etwaigen Contumaciren Frist bitten? Gehorsamst IV. Vollmacht für Dorothea Grabbe und Wilhelmine Wallbaum Ins: am 30ten Sept. 1833 Reuter Hrn: Auditeur Grabbe. 8. Anfrage Grabbes bei Syndikus Runnenberg. 10G. P. Wollen Sie wohl in dieser Sache mein Procurator seyn? Und beim etwaigen Contumaciren Frist bitten? Gehorsamst IV. Vollmacht für Dorothea Grabbe und Wilhelmine Wallbaum  Sowohl bei meinem Leben als meinem Tod gebe ich aus 15guten Gründen hiermit meiner Mutter und ihrer Magd, nämlich der Wilhelmine Walbaum von hier, die Erlaubniß mich jederzeit zu besuchen, und verlange, daß ohne deren Wissen nichts aus meinem Hause entfernt werden soll, sie auch dabei sind, wenn meine Frau, die ich sonst sehr schätze, wie ich 20hiermit bezeuge, irgend eine Stube oder ein Möbel aufbrechen läßt. Detmold den 10t Nov. 1833. V. Übersicht über die bereits im Druck er schienenen, die in Arbeit befindlichen und die geplanten Werke. 25[Düsseldorf,] 27. Juli 1835. Sowohl bei meinem Leben als meinem Tod gebe ich aus 15guten Gründen hiermit meiner Mutter und ihrer Magd, nämlich der Wilhelmine Walbaum von hier, die Erlaubniß mich jederzeit zu besuchen, und verlange, daß ohne deren Wissen nichts aus meinem Hause entfernt werden soll, sie auch dabei sind, wenn meine Frau, die ich sonst sehr schätze, wie ich 20hiermit bezeuge, irgend eine Stube oder ein Möbel aufbrechen läßt. Detmold den 10t Nov. 1833. V. Übersicht über die bereits im Druck er schienenen, die in Arbeit befindlichen und die geplanten Werke. 25[Düsseldorf,] 27. Juli 1835.  1) Herzog Theodor von Gothland, 1) Herzog Theodor von Gothland, | | | | Tragödie. Frkf. a. M. | | (Herm.) | | 2) Nannette und Maria, Tragödie, | | (ib.) |
1) Vgl. dazu die Stelle in Grabbes Brief an den Regierungsrat von Meien vom G06S0036Z3910. Juli 1833: „Sodann bleibt es zwischen mir und ihr auch in jeder Art beim Früheren, und sie mag, sofern sie dem Gemeingut nicht schadet, verwalten wie sie will.“ 2) Vgl. G06S0389Z08Nr. 6. 3) Evictio ist die rechtliche Entwehrung, wodurch man Jemand aus dem Besitz setzt, sodann aber auch die Gewähr der Schadloshaltung für den durch die Entwehrung um den Besitz Kommenden. 4) Vgl. G06S0036Z34S. 36, Z. 34-35. 5) Vgl. G06S0040Z07S. 40, Z. 5-6. 6) Vgl. dazu auch die Ausführungen des Bearbeiters in Jg. 57 der „Deutschen Literaturzeitung“, Heft 19, vom 10. Mai 1936, Sp. 800 bis 801. 7) Vgl. Glaubw. S. 542, Anm. 12. 1) Randbemerkung: „Beweisen Sie, u. ob er nicht geöffnet.“ 2) Randbemerkung: „Acceptire“; die Worte „auf meine Arbeitsstube “ unterstrichen. 3) Randbemerkung: „War ehrenhaft.“ 4) Randbemerkung: „Mit Recht.“ 5) Randbemerkung: „Acceptire dieses Geständniß.“ 6) Randbemerkung: „Hats vielleicht nicht begriffen, was Rechtens. “ 7) Mit diesem Worte beginnt die dritte Seite, in deren oberer rechter Ecke Grabbe mit Tinte bemerkt hat: „p. 3.“ 8) Randbemerkung: „Thut mir leid, da der Hr. FS. die Kosten tragen wird. Acceptire auch dieses Geständniß“. 9) Bemerkung zwischen den Zeilen: „(Nicht wahr. Ich fragte erst.)“ 10) Randbemerkung: „Schlage mich und rathe mir ruhiges Nachdenken an.“ 11) Randbemerkung „Injurien!! von Kestner.“ 12) Randbemerkung: „Dito Injurien von Kestner.“ 13) Die Worte „(aus-)gegeben [bis] Ge-(genwart)“ am Rande angestrichen; daneben die Bemerkung: „Acceptirt.“ 14) Die Worte „(Ge-)genwart [bis] zurück-(gebrachte)“ am Rande angestrichen; daneben die Bemerkung: „Acceptirt.“ 15) Die Worte „(zurück-)gebrachte [bis] darauf“ am Rande angestrichen; daneben die Bemerkung: „dito.“ 16) Die Worte „die Klage [bis] entwerfen“ unterstrichen. Die Worte „genauesten [bis] den-(noch)“ am Rande angestrichen; daneben die Bemerkung: „Acceptirt!!!“ 17) Die Worte „den Kläger [bis] Wissen-(schaft)“ am Rande angestrichen; daneben die Bemerkung: „Acceptirt, u. ein fremder Jurist räth einem Juristen in solchen Sachen!“ 18) Randbemerkung: „non“. 19) Randbemerkung zu der Zeile „(da-)mals [bis] unerheblich“: „non.“ 20) Randbemerkung zu den Zeilen „Kaufmann Wist [bis] Zeu(ge) “: „Test. in prop. causa.“ 21) Dies Wort unterstrichen; am Rande ein Fragezeichen. 22) Dies Wort unterstrichen; dazu die Randbemerkung: „Injuria.“ 23) 24) 25)[GAA, Bd. VI, S. 392] Anmerkungen [GAA, Bd. VI, S. 394] ABKÜRZUNGEN UND SIGLEN I. GESAMT-AUSGABEN VON GRABBES WERKEN WBI = Christ. Dietr. Grabbe's sämmtliche Werke u. handschriftlicher Nachlaß. Erste kritische Gesammtausgabe. Hrsg. u. erl. von Oskar Blumenthal. Bd 1—4. Detmold, Meyer 1874. Übergegangen in den Verlag der G. Grote'schen Buchhandlung, Berlin 1875. WGr = Christian Dietrich Grabbe's sämtliche Werke. In vier Bänden hrsg. mit textkritischen Anhängen u. der Biographie des Dichters von Eduard Grisebach. Berlin, Behr 1902. WN = Christian Dietrich Grabbes sämtliche Werke in sechs Bänden. Vollständige Ausgabe mit den Briefen von u. an Grabbe. Hrsg. u. mit Einleitungen u. Anmerkungen vers. von Otto Nieten. Bd 1—6. Leipzig, Hesse [1908]. WFrZ = Grabbes Werke. Hrsg. von Albin Franz u. Paul Zaunert. Kritisch durchges. u. erl. Ausgabe. Bd 1—3. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut (1910). WW = Grabbes Werke in sechs Teilen. Hrsg. mit Einleitungen u. Anmerkungen vers. von Spiridion Wukadinović. Berlin [usw.], Bong (1912). II. BÜCHER ADB = Allgemeine Deutsche Biographie. Dewall = Die lippischen Offiziere im Reichskontingent und im Füsilier-Bataillon Lippe bis zu dessen Auflösung im Jahre 1867. Von Generalmajor Hans von Dewall († 1923). In: Beiträge zur Westfälischen Familienforschung. Bd 21. 1963. S. 38—81. Duller = Grabbe's Leben von Eduard Duller. In: Die Hermannsschlacht. Drama von Grabbe. Düsseldorf, Schreiner 1838. S. 3—91. Glaubw. = Die Glaubwürdigkeit der Zeugnisse für den Lebensgang und Charakter Christian Dietrich Grabbes. Eine quellenkritische Untersuchung. Von Alfred Bergmann. Berlin, Ebering 1933. (Germanische Studien. H. 137.) Goed. = Grundriß zur Geschichte der Deutschen Dichtung. Aus den Quellen von Karl Goedeke. Göttinger Matrikel = Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734—1837. Im Auftrage der Universität hrsg. von Götz von Selle. [Bd 1.] Text. Hildesheim & Leipzig, Lax 1937. (Veröffentlichung der Historischen Kommission für Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippi und Bremen. IX.) Ziegler = Grabbe's Leben und Charakter. Von Karl Ziegler. Hamburg, Hoffmann & Campe 1855. [GAA, Bd. VI, S. 395] III. BEITRÄGE ZU ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA. Dortmunder „Mitteilungen“ = Eine Grabbe-Ausstellung. (Zusammengestellt und kommentiert von Hedwig Gunnemann.) In: Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. Mitteilungen — Neue Folge. Hrsg.: Hans M. Meyer. H. 2. Christian Dietrich Grabbe 11. 12. 1801 — 12. 9. 1836. 1961. S. 13—40. Gegenw. = Bunte Mittheilungen aus Grabbes handschriftlichem Nachlaß. Von Oskar Blumenthal. In: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst u. öffentliches Leben. Hrsg. von Paul Lindau. Bd 3. Berlin 1873. No 1. 4. Jan. S. 8—11. No 2. 11. Jan. S. 25—29. No 13. 29. März. S. 205—207. No 16. 19. April. S. 251—252. Grabbe als Benutzer = Grabbe als Benutzer der Öffentlichen Bibliothek in Detmold. Von Alfred Bergmann. In: Archiv für Landes- u. Volkskunde von Niedersachsen. Bd 1944. H. 20. Ausgegeben April 1944. S. 62—118. Hallgarten = Neues von Grabbe. Von Robert Hallgarten. In: Das literarische Echo. Jg. 4. H. 5. Dez. 1901. Sp. 293—301. Hillekamps = Neue Grabbebriefe. (Zum erstenmal veröffentlicht.) Mitget. von Carlheinz Hillekamps. In: Der Friedenssaal. Osnabrück. Jg. 2. H. 7. April 1928. S. 195—199. PrJbb. = Grabbes Entlassung aus dem Amte. Die Zerstörung einer Legende. Nach den bisher unbenutzten Auditeurs-Akten des Lippischen Landes-Archivs in Detmold dargest. von Alfred Bergmann. In: Preußische Jahrbücher. Bd 233. H. 3. Sept. 1933. S. 244—263. Rheinland = Aus Grabbe's Billets an die Mademoiselle Clostermeier (seine spätere Gattin). Mittheilung von Frank von Steinach [d. i. Ignaz Hub]. In: Das Rheinland wie es ernst und heiter ist. Mainz. Jg. 5. Red. von Dr. Fr. Wiest. Nr 148. 12. Dez. 1841. S. 590—591. Rundschau = Briefe von Christian Grabbe. [Mitget. von Eduard Grisebach.] In: Neue Deutsche Rundschau. (Freie Bühne.) Jg. 13. 3. u. 4. Quartal. 1902. S. 1033—1039. Salon = Grabbe'sche Reliquien. [Mitget. von] Oscar Blumenthal. In: Der Salon für Literatur, Kunst u. Gesellschaft. Hrsg. von Julius Rodenberg. Bd 1. Leipzig 1874. S. 179—193. TdrO = Grabbe. Erzählung, Charakteristik, Briefe. November 1834 bis Mai 1836. Bruchstück eines noch ungedruckten Werks: „Dramaturgische Erinnerungen“ von Karl Immermann. In: Taschenbuch dramatischer Originalien. Hrsg. von Dr. Franck [d. i. Gustav Ritter von Frank]. Jg. 2. Leipzig, Brockhaus 1838. S. I-CXII. Wagner = Aus Grabbes Düsseldorfer Tagen. Von Albert Malte Wagner. In: Preußische Jahrbücher. Bd 174. Okt. bis Dez. 1918. S. 214—221. Willkomm = Silhouetten dramatischer Dichter. Von E.[rnst] Willkomm. 1. Grabbe. In: Jahrbücher für Drama, Dramaturgie und Theater. Hrsg. von E. Willkomm u. A.[lexander] Fischer. Bd 1. Leipzig, Wunder 1837. S. 67—76. [GAA, Bd. VI, S. 396] IV. AKTEN-FASZIKEL. Aud.-Akt. = Acta die Anstellung eines Auditeurs betr. (Staatsarchiv Detmold.) Vol: I. 1791—1828. L 77 C I Fach 50. Nr. 1T [Nr 1—110.] Vol: II. 1828—1842. L 77 C I Fach 50, Nr. 1TT [Nr 111—238.] V. ÖFFENTLICHE INSTITUTE DStBB = Deutsche Staatsbibliothek Berlin. GrA = Grabbe-Archiv der Lippischen Landesbibliothek Detmold. LBD = Landesbibliothek Detmold. NFG [GSA] = Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen Deutschen Literatur in Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv). StAD = Staatsarchiv Detmold. StLBD = Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. HHI = Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf. VI. EINZELNE WORTE UND WENDUNGEN A = Abschrift. aRl = am Rande links. angestr. = angestrichen. Br = Bruchstück. D = Druck (Erstdruck). Kommen mehrere Drucke in Betracht, so ist die Bezeichnung: D, D1 usw. Drf = Druckfehler. E = Eigentümer. eingef. = eingefügt. F = Fundort. Faks. = Faksimile. gestr. = gestrichen. H = Handschrift. IW = Konvolut der Briefe Grabbes an Immermann in dessen Nachlaß. (NFG [GSA]) K = Kopie. T = Teildruck. üdZ = über der Zeile. unterstr. = unterstrichen. Z = Zitat. Winkelklammern (<>) bedeuten, daß die eingeklammerte Stelle sogleich wieder gestrichen worden ist. |
| |



