| Nr. 148, siehe GAA, Bd. V, S. 201 | 12. Januar 1828 |  | | Christian Dietrich Grabbe (Detmold) an Georg Ferdinand Kettembeil (Frankfurt a. M.) | | Brief | | | | Vorangehend:  | Nachfolgend:  |
|  Westphalia, eine Zeitschrift — 5. Jan. 1828. 1stes Stück. Zur Litteratur. Grabbe's dramatische Dichtungen. (2 Theile.) 5 „„Der Verfasser, welcher mit diesen Werken zum erstenmale und auf eine ausgezeichnete Weise sich dem Publicum vorstellt, ist unser junger Landsmann, wie wir in Detmold geboren und lebt jetzt (etwa 25 Jahr alt) in seiner Vaterstadt als Advocat. Schon früh zeigte er Anlage zum Dichter und bei seinen 10academischen Studien in Leipzig und Berlin beachtete er die Kunst immer neben seinen Fachwissenschaften. In oder gleich nach diesen Jahren (1822) entstanden die hier mitgetheilten Arbeiten. Sie blieben einstweilen im Pulte liegen und der Verfasser äußert selbst, daß er in den nächsten fünf Jahren wenig 15aesthetica angesehen habe (II, 343.) Er gewann mitlerweile Anerkennung als geschickter und fleißiger Rechtsanwald. Im vorigen Jahre bot sich ihm Gelegenheit dar (Th. 1. Vorwort,) jene früheren Producte drucken zu lassen und er legt sie, ohne die etwa gewonnene größere Reife mancher Ansichten und Fertigkeiten 20zu mehr als einer Revision zu benutzen, dem Publicum als Talentprobe vor. „Erklärt die öffentliche Stimme, daß gute Erwartung von seinen dichterischen Anlagen zu fassen ist, so wird er diese Erwartung bald mehr befriedigen, als er bisher gethan hat. Er würde vielleicht schon jetzt Proben darüber 25abgelgt haben, aber gesteht es offenherzig, daß seine Individualität und seine bürgerliche Stellung ihm nicht erlauben, eher einen weitern Vorschritt zu machen, als bis durch die vorgelegten früheren Producte die Anfänge seiner litterarischen Verhältnisse zum Publicum festgesetzt sind.“ Auf 30ähnliche Weise erklärt sich das Vorwort zu der unvollendeten Tragödie Marius und Sulla (II. 193): „sie wird dem Publico mit der Bitte dargeboten, zu entscheiden, ob sie der Vollendung werth ist oder nicht? Der Verfasser wird dem Urtheil, es heiße wie es wolle, folgen.“ 35 Westphalia, eine Zeitschrift — 5. Jan. 1828. 1stes Stück. Zur Litteratur. Grabbe's dramatische Dichtungen. (2 Theile.) 5 „„Der Verfasser, welcher mit diesen Werken zum erstenmale und auf eine ausgezeichnete Weise sich dem Publicum vorstellt, ist unser junger Landsmann, wie wir in Detmold geboren und lebt jetzt (etwa 25 Jahr alt) in seiner Vaterstadt als Advocat. Schon früh zeigte er Anlage zum Dichter und bei seinen 10academischen Studien in Leipzig und Berlin beachtete er die Kunst immer neben seinen Fachwissenschaften. In oder gleich nach diesen Jahren (1822) entstanden die hier mitgetheilten Arbeiten. Sie blieben einstweilen im Pulte liegen und der Verfasser äußert selbst, daß er in den nächsten fünf Jahren wenig 15aesthetica angesehen habe (II, 343.) Er gewann mitlerweile Anerkennung als geschickter und fleißiger Rechtsanwald. Im vorigen Jahre bot sich ihm Gelegenheit dar (Th. 1. Vorwort,) jene früheren Producte drucken zu lassen und er legt sie, ohne die etwa gewonnene größere Reife mancher Ansichten und Fertigkeiten 20zu mehr als einer Revision zu benutzen, dem Publicum als Talentprobe vor. „Erklärt die öffentliche Stimme, daß gute Erwartung von seinen dichterischen Anlagen zu fassen ist, so wird er diese Erwartung bald mehr befriedigen, als er bisher gethan hat. Er würde vielleicht schon jetzt Proben darüber 25abgelgt haben, aber gesteht es offenherzig, daß seine Individualität und seine bürgerliche Stellung ihm nicht erlauben, eher einen weitern Vorschritt zu machen, als bis durch die vorgelegten früheren Producte die Anfänge seiner litterarischen Verhältnisse zum Publicum festgesetzt sind.“ Auf 30ähnliche Weise erklärt sich das Vorwort zu der unvollendeten Tragödie Marius und Sulla (II. 193): „sie wird dem Publico mit der Bitte dargeboten, zu entscheiden, ob sie der Vollendung werth ist oder nicht? Der Verfasser wird dem Urtheil, es heiße wie es wolle, folgen.“ 35  Dieses mußten wir, theils des Verfassers, den wir übrigens nicht persönlich kennen, theils unsrer selbst wegen bemerken, um den Lesern ein Urtheil über unser Urtheil möglich zu machen. Dem Landsmanne wird die Unpartheilichkeit schwer, weil entweder Eifersucht und Neid ihn übelwollend, oder 40Vorliebe zu nachsichtig stimmen und er thäte darum in der Dieses mußten wir, theils des Verfassers, den wir übrigens nicht persönlich kennen, theils unsrer selbst wegen bemerken, um den Lesern ein Urtheil über unser Urtheil möglich zu machen. Dem Landsmanne wird die Unpartheilichkeit schwer, weil entweder Eifersucht und Neid ihn übelwollend, oder 40Vorliebe zu nachsichtig stimmen und er thäte darum in der [GAA, Bd. V, S. 202] Regel besser, zu schweigen. Indem wir aber als Redacteur bestimmt zur Abgabe unsers Urtheils aufgefordert wurden, können wir uns derselben nicht entziehen und hoffen auch wenigstens unser Streben nach voller Gerechtigkeit den Verständigen 5zu bewähren. Es mögen zuförderst die einzelnen Stücke gewürdigt werden und dann diejenigen Bemerkungen, welche die Gesammtheit betreffen um so faßlicher nachfolgen. 1. Herzog Theodor von Gothland, eine Tragödie in fünf 10Acten (Th. 1. ganz; 400 S.) Eine Tragödie, die wir theils ihres Umfangs, theils ihres Baues und theils endlich ihres Charakters wegen für kein Theaterstück im nächstliegenden Sinne halten können, aber nichts desto minder für eins der ausgezeichnetsten Dramen, 15die nach Schillers Tode erschienen, erklären müssen. Tiek, dem der Verf. dieselbe in der Handschrift mittheilte und dessen in Antwort gegebenes briefliches Urtheil darüber dem Werke vorgedruckt ist, hat den eigentlichen Geist derselben offenbar gar nicht verstanden und thut dem Verf. mehr Unrecht als 20Ehre an. Es wundert uns darum, wie letzterer den Aeußerungen eines Dichters, dessen kritisches Talent sich nie als ein sonderliches erwieß, sichtlich eine solche Bedeutung beimessen konnte. Entweder ist dies eine übertriebene Bescheidenheit, oder ästhetische Unklarheit, wenn nicht eine Mischung 25von beiden. Wir aber müssen eben deswegen ihn hier zunächst gerade gegen Tieks Mißdeutung in Schutz nehmen. Die Idee des Stücks ist eine ächt, ja unterscheidend christliche und von dem Vf., was die Hauptumrisse betrifft, sehr rein aufgefaßt und sehr folgerecht, im Allgemeinen auch sehr 30poetisch ausgeführt. Das wahrhaft Tragische ist, wie wir dieses im fünften Theile der Wanderjahre weiter ausführten, immer ein göttlich Gegebenes, wobei blos der Glaube des Menschen vorausgesetzt und angesprochen wird, um es aufzufassen. Die eigentlich 35religiöse Poesie ausgenommen, ist darum keine andere Art von Dichtungen dem geltenden Glauben enger verknüpft,  als die Tragödie. Mit dem sich verändernden Geist des Glaubens ändern sich auch die tragischen Ideen, welche der Dichter und das Volk verstehen, und die Idee des Schicksals z. B. ist so 40wenig bei den Griechen als bei den Muhamedanern oder Indiern (Sakontala) dieselbe, wie sie, um anzusprechen, bei als die Tragödie. Mit dem sich verändernden Geist des Glaubens ändern sich auch die tragischen Ideen, welche der Dichter und das Volk verstehen, und die Idee des Schicksals z. B. ist so 40wenig bei den Griechen als bei den Muhamedanern oder Indiern (Sakontala) dieselbe, wie sie, um anzusprechen, bei [GAA, Bd. V, S. 203] dem Christen seyn muß. Unsere frühere Behauptung, daß die christliche Religion auch die schönste sei und daß es nur an der Auffassung des Dichters liege, um dieses darzuthun, bewährt sich hier besonders. Sie hat vornämlich drei tragische 5Ideen in den Kreis der Volksansichten eingeführt, denen keine andere gleich kommen und die auch mit hundertfachen Variazionen allen gelungenen und mit dem allgemeinen Beifall gekrönten neueren Tragödien, so wie zahllosen Romanen und Novellen zum Grunde liegen. Ob dieses mit oder ohne Bewußtseyn 10des Dichters war, gilt hier gleich; ja das bewußtlose Aufnehmen beweißt für unsern Hauptsatz fast noch mehr als das absichtliche. Die erste Stelle in dieser Dreizahl der durch das Christenthum geltend gemachten tragischen Ideen gebührt dem Ur- 15sprung des Bösen oder dem Abfall vom Guten oder von Gott. Unsere Religion zuerst stellt das Böse dem Guten diagonal entgegen und zwar nicht im Sinne des Zerduscht oder des ebenfalls persischen Manichäismus, sondern wie die neuere Chemie die Kälte dem Wärmestoff, sodaß 20das Böse erst durch die Verneinung des Guten oder durch einen Abfall von diesem, gleichwie die Kälte durch das Verschwinden des Wärmestoffs, erklärt wird. Sie lehrt also nicht einen Gott und Gegengott, wohl aber eine vom Göttlichen abgesunkene Gewalt, die sich für den in der Mitte stehenden 25Menschen in einem Gegensatze als böses Prinzip conzentrirt. Characteristisch ist in dieser Vorstellung, daß das Böse einst gut war aber einmal abgefallen einem entgegenstehenden Extreme zueilt, von welchem aus es sich gezogen fühlt. Das ist die Lehre vom Teufel, der Hölle und Quaal, die in der 30Geschichte des Christenthums (d. i. in dessen Fortleben unter den sich zu ihm bekennenden Völkern) eine so bedeutende und merkwürdige Erscheinung ist. Es ist aber auch die Lehre vom Fall der ganzen Menschheit, wie des einzelnen Menschen,  sodaß jener Fall der Engel als symbolisirte Abstraction oder 35mindestens als Parallelismus dieses letztern gedeutet werden könnte.““ (Fortsetzung folgt.) Bester, liebster Freund, obige Recension ist vom Redacteur der Westphalia, Herrn 40Fr. Pustkuchen, Verf. der falschen Wanderjahre. Er hat das höchste gesagt, was Er (dessen schriftstellerischen Character sodaß jener Fall der Engel als symbolisirte Abstraction oder 35mindestens als Parallelismus dieses letztern gedeutet werden könnte.““ (Fortsetzung folgt.) Bester, liebster Freund, obige Recension ist vom Redacteur der Westphalia, Herrn 40Fr. Pustkuchen, Verf. der falschen Wanderjahre. Er hat das höchste gesagt, was Er (dessen schriftstellerischen Character [GAA, Bd. V, S. 204] Du kennen mußt) sagen konnte: er findet Tiecks Lob zu schlecht, hält mich für bedeutend nach Schiller (sein geachtetster Dichter) und findet den Gothland — — — echt christlich. Ihm huldigt bekanntlich die pietistisch poetische Partei. — 5Ich bin begierig auf die Continuation. — Die Geschichte im Gesellschafter? Gubiz schickt sie mir eben zu. Sehr brillant. Aber ich selbst? Wahrhaftig nicht, jedoch zweifelsohne die Veranlassung, denn (ich müßte mich sonst ungeheuer irren) es ist Köchy nach meiner Instruction und mit eigenem Geiste 10dazwischen. Das ist besser als wär' ich's selbst, und Du siehst, er versteht's. — Wenn Du sie noch missen kannst, so könnt' ich noch ein paar Exemplare meiner Werke gebrauchen, wenigstens 2 Gothlands, indem ich den 2ten Theil durch ein Versehen, veranlaßt vom Buchbinder, doppelt erhalten 15habe. Übrigens nochmals: Du mußt sie bequem missen können; nöthigenfalls leg ich meine Feuerfunken auch ohnedem an. — Apropos, mein Vorfahr ist todt, ich bin jetzt nicht mehr bloßer Advocat, sondern „Auditeur“. — Unsere Hofschauspieler mußten nach Münster, — sie zittern 20vor mir, — Münster ist Westphalens erste Stadt, es ist von mir gesorgt, daß sie dort meinen Namen hinbringen, — ja, ich habe ihnen mit einem Prologe gedient, der bereits großen Beifall dort erhalten. — Immer Feuer angelegt, sey es noch so klein. — Betreib Du auch die Recensionen und theile sie 25mir mit; Kunz muß und wird wohl bald losgehen, — das Morgenblatt wirkt. — Und großer Gott! wenn sie nur schimpfen! Mehr verlange ich  nicht, — dann stehe ich [auf dem Posten des] Vertheidigers. Der Vertheidiger ist ein Narr, der nicht bald zu[m An]greifer wird. — Auch Ruhe wird nun 30ziemlich bald; verlaß Dich darauf, ich fange bald an weiter zu poetisiren, könnte auch wissenschaftelisiren. — Der Köchy hat mir noch keine Antwort geschrieben, soll aber noch in mehreren Blättern auflodern. — Immer und ewig die verwünschte Post: sie geht nämlich Morgens 8½ Uhr fort und 35ich stehe frühestens 8 Uhr auf, so sehr ich mir auch das Gegentheil vornehme. Ich habe ein schläferiges Herz, es hat Rostflecken, ich muß es putzen. — Ich möchte die Augen des Herrn von Uechtriz sehen. Der Sclave! Soll ich dem Börne um ihn zu reitzen einen Brief schreiben? Es wird mir aber 40schwer werden. Bei Katholiken gib mich nur für bekehrt und katholisch aus, und bei Juden meinetwegen für einen nicht, — dann stehe ich [auf dem Posten des] Vertheidigers. Der Vertheidiger ist ein Narr, der nicht bald zu[m An]greifer wird. — Auch Ruhe wird nun 30ziemlich bald; verlaß Dich darauf, ich fange bald an weiter zu poetisiren, könnte auch wissenschaftelisiren. — Der Köchy hat mir noch keine Antwort geschrieben, soll aber noch in mehreren Blättern auflodern. — Immer und ewig die verwünschte Post: sie geht nämlich Morgens 8½ Uhr fort und 35ich stehe frühestens 8 Uhr auf, so sehr ich mir auch das Gegentheil vornehme. Ich habe ein schläferiges Herz, es hat Rostflecken, ich muß es putzen. — Ich möchte die Augen des Herrn von Uechtriz sehen. Der Sclave! Soll ich dem Börne um ihn zu reitzen einen Brief schreiben? Es wird mir aber 40schwer werden. Bei Katholiken gib mich nur für bekehrt und katholisch aus, und bei Juden meinetwegen für einen [GAA, Bd. V, S. 205] Juden, — was frag' ich nach der Chaussée, wenn ich nur die Stadt erreiche. — Pass' auf, mit meiner Kritik stifte ich noch Unheil, — wir müssen einige zerreißen, ich bin hungrig, bereits todtes Aas mag ich nicht. Auch ein gewisser Herr 5Wessenberg (der Pfaffe) mit seinen Schriften über Theater und Romane (so gepriesen!) soll an mich denken, und, was die eigentliche Tendenz ist, mit ihm eine ganze Classe. Jede Religion ist trefflich, wenn man sie trefflich interpretirt, — Herr Gott | | | die Post! | | | | Ich schließe, bald mehr, | | | | | | | | schreib Du bald | | Detmold den 13t [richtig: 12t] Januar. | | Deinem | | 1828 | | alten schnöden Grabbe. |
[Adresse:]  An die Hermannsche Buchhandlung (Herrn Buchhändler Kettembeil) Wohllöblich in Frankfurt am Main. Frei. An die Hermannsche Buchhandlung (Herrn Buchhändler Kettembeil) Wohllöblich in Frankfurt am Main. Frei. |
| |


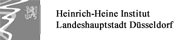


148.
H: 1 Doppelbl., 1 Bl. in 40; 5 S., Adresse auf S. 6. Die Abschrift
der Rezension von der Hand eines Schreibers. Auf S. 6 Vermerk
des Empfängers: 1828 Grabbe in Detmold den 13. Jan. Abgangsstempel:
DETTMOLD 12/1 Ankunftsstempel: FRANKFURT 16.
IAN. 1828
F: GrA
D: WBl IV 422—27, als Nr 13.
S. 202, Z. 31: Tragische] tragische H
S. 204, Z. 27 f.: [auf dem Posten des]] der Brief ist an dieser
Stelle mit Textverlust beschädigt; in WBl (IV 427,7) findet sich die
ergänzte Stelle noch. Gleiches gilt von der folgenden Ergänzung,
Z. 29.
S. 205, Z. 14: 13t [richtig: 12t]] Zur Umdatierung vgl. den
Abgangsstempel; daß das Datum noch weiter zurückverlegt werden
müsse, ist wohl nicht wahrscheinlich.
S. 202, Z. 31 f.: wie wir dieses im fünften Theile der Wanderjahre
weiter ausführten: Vornehmlich im zweiten Kapitel (S. 38—47),
im Gespräche zwischen Coucy, Ludolf, Wilhelm Meister und Junius.
Aber auch an späteren Stellen (S. 102—06 u. 169—71) wird dieses
Problem gestreift.
S. 202, Z. 41: Sakontala: „Çakuntalâ“ ist eines der Dramen des
indischen Dichters Kâlidâsa. Die Titelheldin ist die Pflegetochter
des frommen Einsiedlers Kanva. König Duhschanta vermählt sich
mit ihr, erkennt sie aber, als sie an seinen Hof kommt, infolge
eines Fluches nicht wieder. Die Verzweifelnde wird in das Reich
der Genien entrückt, nachher aber ein verlorener Erkennungsring
wiedergefunden und dadurch der König mit seiner Gattin wiedervereinigt.
S. 203, Z. 18: Zerduscht: Zerdusht heißt bei den Parsen der
Stifter der dualistischen Glaubenslehre der alten Iranier, im Zendavesta
Zarathushtra genannt.
S. 203, Z. 18: des ebenfalls persischen Manichäismus: Die Religionsform
des M. war aus dem babylonischen Gnostizismus erwachsen
und mit christlichen Vorstellungen durchsetzt. Sie blühte im
dritten Jahrhundert auf, verbreitete sich rasch von den Grenzen
Indiens bis nach Nordafrika, wurde aber seit 377 von der christlichen
Kirche und bald auch im Perserreiche hart verfolgt und schließlich
unterdrückt. Ihr Stifter Mani (Manes, Manichäus) war 215/216
von persischen Eltern in Babylonien geboren, trat 242 mit seiner
Lehre hervor und fiel 276 dem Hasse der persischen Priester zum
Opfer. Das charakteristische Merkmal des M. ist ein ausgeprägter
Dualismus. Er nimmt zwei Grundwesen an, die von Ewigkeit zu
Ewigkeit räumlich nebeneinander bestehen und einander direkt entgegengesetzt
sind.
S. 204, Z. 5 f.: Die Geschichte im Gesellschafter: Die mit „Pr.“
gezeichnete Besprechung findet sich in der „Zeitung der Ereignisse
und Ansichten“, der Beilage zum 205ten Blatte des „Gesellschafters“
vom 24. Dez. 1827, S. 1023—28. Zu den von Grabbe vermuteten
Zusammenhängen läßt sich, aus Mangel an Brief- und anderem
[Bd. b5, S. 544]
Material, nichts sagen; auch Gubitzens Bemerkungen („Erlebnisse“
Bd 2, Berlin 1868, S. 254) geben keine Aufklärung. In Goed.2 VIII,
637 wird unter 1) die Vermutung ausgesprochen: „wahrscheinlich
Köchy, von Grabbe 'instruiert', d. h. der größte Teil der Rezension
ist Selbstberäucherung.“
S. 204, Z. 22: mit einem Prologe: Dieser hat sich, soweit bekannt,
nicht erhalten. Unterm 20. Oktober 1841 berichtet Louise Christiane
Grabbe an Freiligrath, sie habe in Mannheim, wo sie zu Besuch
war, den Schauspieler Braunhofer aufgesucht, dieser habe sich des
einst für ihn gedichteten Prologs noch recht gut erinnert, ihn aber
nicht mehr besessen. („Ferdinand Freiligraths Briefwechsel mit der
Familie Clostermeier in Detmold“, hrsg. von Alfred Bergmann,
Detmold 1953, S. 149.)
S. 204, Z. 32 f.: soll aber noch in mehreren Blättern auflodern:
Irgendwelche Besprechungen der „Dramatischen Dichtungen“ aus
Köchy's Feder sind nicht bekannt.
S. 205, Z. 4 f.: Herr Wessenberg (der Pfaffe) mit seinen Schriften
über Theater und Romane: Der katholische Theolog Ignaz
Heinrich Karl Freiherr von W. (1774—1860) war 1802 von Karl
von Dalberg zum Generalvikar und Präsidenten der geistlichen
Regierung des Bistums Konstanz ernannt worden, jedoch durch seine
Reformideen in einen Gegensatz zum päpstlichen Stuhle getreten.
Deswegen stimmte dieser nicht zu, als Dalberg 1815 beabsichtigte,
W. zu seinem Weihbischof und Koadjutor zu ernennen, und ebenso
versagte er seine Bestätigung, als W. 1817 nach Dalbergs Tode zum
Bistumsverweser ernannt wurde. Trotzdem verwaltete W. sein Amt,
bis 1827 das Bistum Konstanz infolge eines Konkordates aufgelöst
wurde. Seitdem lebte er als Privatmann in Konstanz, war aber auch
als Abgeordneter in der ersten Kammer des badischen Landtags
tätig. Im Verlage von Wallis in Konstanz erschienen von ihm 1825
„Ueber den sittlichen Einfluß der Schaubühne“ (2., sehr verm. u.
verb. Ausg. im selben Jahre) und 1826 der Versuch „Ueber den
sittlichen Einfluß der Romane“.