| Nr. 131, siehe GAA, Bd. V, S. 177 | 12. August 1827 |  | | Christian Dietrich Grabbe (Detmold) an Georg Ferdinand Kettembeil (Frankfurt a. M.) | | Brief | | | | Vorangehend:  | Nachfolgend:  |
|  Mein bester Freund, Deine Freude über meine Shakspearo-Manie ist mir lieber als der Aufsatz selbst. Seine Folgen? Ich hoffe er stößt Manches 20um, denn so deutlich ist nicht oft gegen Shakspeare gesprochen; auch denke ich, er zieht mir eine Partei Anhänger und eine Partei Kläffer zu. Ich gestehe, er ist vorzüglich mitberechnet, dem Tieck i. e. seiner albernen Kritik den Todesstoß zu geben. Ich mußte, (wie ich höchstens einmal 25mündlich näher entwickeln könnte) ihn in Worten schonen, aber indem ich den Götzen angreife, zu dessen Pabst er sich aus Mangel eigener Kraft machen will (auch diese Worte kann Tieck, wenn er lärmt, einmal gedruckt zu lesen bekommen), so zertrümmere ich auch ihn. Da Tiecks 30unvorsichtiges Benehmen ihm schon unter dem Dichterpöbel Feinde zugezogen hat, die öffentlich, selbst in der Modezeitung, gegen ihn auftreten, so hoffe ich den Matadors-Ruhm zu erlangen. Geht er oder einer seiner Anhänger los, ich stehe mit mehr Materie und gröberer Form zu Diensten, ohne 35Reserve thue ich keinen Schritt. Tiecks Kritik ist Manchem schon so verdächtig, daß ihm der jetzige Verfall der Litteratur zugeschrieben wird, Müllner hat ihn schon tüchtig gebissen, Dr. Gans desgleichen, und eben deshalb weiß ich nicht, ob, wie ich in meiner Ankündigung der Dramen geschrieben, wir Mein bester Freund, Deine Freude über meine Shakspearo-Manie ist mir lieber als der Aufsatz selbst. Seine Folgen? Ich hoffe er stößt Manches 20um, denn so deutlich ist nicht oft gegen Shakspeare gesprochen; auch denke ich, er zieht mir eine Partei Anhänger und eine Partei Kläffer zu. Ich gestehe, er ist vorzüglich mitberechnet, dem Tieck i. e. seiner albernen Kritik den Todesstoß zu geben. Ich mußte, (wie ich höchstens einmal 25mündlich näher entwickeln könnte) ihn in Worten schonen, aber indem ich den Götzen angreife, zu dessen Pabst er sich aus Mangel eigener Kraft machen will (auch diese Worte kann Tieck, wenn er lärmt, einmal gedruckt zu lesen bekommen), so zertrümmere ich auch ihn. Da Tiecks 30unvorsichtiges Benehmen ihm schon unter dem Dichterpöbel Feinde zugezogen hat, die öffentlich, selbst in der Modezeitung, gegen ihn auftreten, so hoffe ich den Matadors-Ruhm zu erlangen. Geht er oder einer seiner Anhänger los, ich stehe mit mehr Materie und gröberer Form zu Diensten, ohne 35Reserve thue ich keinen Schritt. Tiecks Kritik ist Manchem schon so verdächtig, daß ihm der jetzige Verfall der Litteratur zugeschrieben wird, Müllner hat ihn schon tüchtig gebissen, Dr. Gans desgleichen, und eben deshalb weiß ich nicht, ob, wie ich in meiner Ankündigung der Dramen geschrieben, wir [GAA, Bd. V, S. 178] bloß von einen „großen Dichter“, der einen Brief über den Gothland geschrieben, reden, oder dahinter in Klammern setzen („L. Tieck“). Thue wie Du willst und richte Dich nach den Städten, wo Tieck noch Anhänger hat. — Den 5Brief Tiecks können wir nicht missen; auf Manchen wirkt er noch immer, und, wie Du so gut geahnt hast, meine Shakspearo -Manie zeigt, indem sie ihn kritisiert, jedem Vernünftigen meinen eigentlichen Zweck. Den lieben Brief, der den Gothland doch immer als ganz besondere von allem Übrigen 10verschiedene furchtbare Erscheinung anzeigt, benutze ich wie ein Instrument, ja, wie eine eben eroberte, nun gegen den Feind gerichtete Kanone. Vielleicht hast Du ihn schon gedruckt, sonst laß uns am Schlusse desselben, statt der bisherigen Höflichkeitsform setzen: 15 „Diese Anmerkungen zu dem geehrten Schreiben L. Tiecks sollen keine Widerlegungen, sondern nur Andeutungen einiger Ideen seyn, welche den Verf. bei Ausführung seines Werkes leiteten. Der freimüthige und herzliche Tadel, den L. Tieck ausspricht, müßte dem Dichter des Gothland schon 20insofern höchst angenehm seyn, als er die Unparteilichkeit des vielleicht übergroßen Lobes am besten verbürgt. Freilich sind die Ansichten und die poetische Natur des Verfassers viel zu sehr von der Eigenthümlichkeit L. Tiecks verschieden, als daß er glauben könnte, derselbe habe in 25Lob und Tadel hier  und da sein Werk nicht mißkannt. Aber trotz dessen von einem solchen verschiedenartigen Dichter eine so an sich geistreiche und wohlwollende Beurtheilung erhalten zu haben, erfüllt den Beurtheilten jedenfalls mit Freude und Dank. Übrigens pp“ 30 (die Phrase über die Aufführbarkeit des Gothland) — Und nun, Freund, noch dieses: den Druck der Probestellen überlasse ich lediglich Deinem Ermessen, nur beim Gothland wünschte ich, Du nähmst nur die Stellen, die ich Dir proponirt, zu welchen Du auch noch das Auftreten 35Berdoas im 3t Acte „Was? bin ich noch der Neger?“ bis zu der Stelle: „wenn sie nun aus dem Halse stänke (welcher Vers in der Abendzeitung halb oder leiser angedeutet werden könnte) fügen möchtest. Ich habe bei diesen Stellen meine Gründe; Scenen wirken weniger, und Du könntest in 40den Blättern bemerken, es wären keine aus dem Gothl. zu nehmen gewesen, weil sie zuviel Exposition gefodert hätten. und da sein Werk nicht mißkannt. Aber trotz dessen von einem solchen verschiedenartigen Dichter eine so an sich geistreiche und wohlwollende Beurtheilung erhalten zu haben, erfüllt den Beurtheilten jedenfalls mit Freude und Dank. Übrigens pp“ 30 (die Phrase über die Aufführbarkeit des Gothland) — Und nun, Freund, noch dieses: den Druck der Probestellen überlasse ich lediglich Deinem Ermessen, nur beim Gothland wünschte ich, Du nähmst nur die Stellen, die ich Dir proponirt, zu welchen Du auch noch das Auftreten 35Berdoas im 3t Acte „Was? bin ich noch der Neger?“ bis zu der Stelle: „wenn sie nun aus dem Halse stänke (welcher Vers in der Abendzeitung halb oder leiser angedeutet werden könnte) fügen möchtest. Ich habe bei diesen Stellen meine Gründe; Scenen wirken weniger, und Du könntest in 40den Blättern bemerken, es wären keine aus dem Gothl. zu nehmen gewesen, weil sie zuviel Exposition gefodert hätten. [GAA, Bd. V, S. 179] — Hör' mal, laß doch (wenn möglich) den Teufel ja Ritter des päpstlichen Civilverdienstordens bleiben; die Katholiken anpacken, heißt Manchen gewinnen. Daß Deine Verleger-Annonce über das Streichen und Abändern mehr Gestrichenes 5und Abgeändertes andeutet, als vorhanden ist, schadet nicht; immer Sand! Sand! — Den zweiten Band sähe ich am liebsten von der Nannette eröffnet; sie bildet zum Gothland einen größeren Contrast als das Lustspiel, und dann fällt dieses wieder der Nannette auf den Kopf, und dann der Sulla, und 10dann die Shakspearo-Manie als Salz auf die Schnecke. Vor die Nannette, um sie auch nicht ohne Prolog zu lassen, wäre zu setzen: „Vielleicht versöhnt dieses Stück manchen Leser mit dem woran er im Gothland glaubte Anstoß nehmen zu müssen.“. — Du deutest an, alles was ich über die resp. Vorworte 15auf dem Herzen hätte, Dir zu schreiben, aber da kann ich nicht helfen: ich habe nunmehr schon alles darüber geschrieben, es liegt in meinen Briefen zerstreut, und leider (ich erkenne die Qual und Gefälligkeit, welche Du mit der wiederholten Lecture übernimmst) wirst Du wohl es daraus aufsuchen, 20bezeichnen, und an den gehörigen Stellen einschalten müssen. Geht unsere Sache gut, wie ich gar nicht zweifle, so wache ich auf. Wo ich Endzweck sehe, bin ich unermüdlich. Zwei Trauerspiele, zwei Comödien, sechs Abhandlungen über Literatur 25und ihre Heroen, eine Masse Kritiken, auch Wissenschaftlichkeiten, Trotz und Überbietung von allem was mir in den Weg kommt, — das schaffe ich Jahr für Jahr. Und hielte ich das nicht alles im vollsten Ernste für Kleinlichkeiten, welche nur durch die Albernheit der meisten übrigen Scribenten 30eine scheinbare quantitative Größe erlangen, so spräche ich nicht davon, weil es Prahlerei schiene.  Du bietest mir Exemplare an. Ich selbst wünsche nur eins auf gewöhnlichem Papier; den Köchy (der Devrients Tochter jetzt geheirathet hat) wünsche ich als anonymen und publiken 35Ankündiger zu besitzen; für den bitte ich auch um eins; dann eins für unseren Fürsten; und (wenn Du sie missen kannst) noch einige (3 ist schon genug) auf verschiedenem Papier zur eventuellen Nutzanlegung. In Detmold verschenke ich nichts. Die Briefe an die Herren literarischen Hammel 40und Ochsen werde ich nach Frankfurt schicken, jedoch kann ich das erst dann thun, wenn ich mein gedrucktes Exemplar Du bietest mir Exemplare an. Ich selbst wünsche nur eins auf gewöhnlichem Papier; den Köchy (der Devrients Tochter jetzt geheirathet hat) wünsche ich als anonymen und publiken 35Ankündiger zu besitzen; für den bitte ich auch um eins; dann eins für unseren Fürsten; und (wenn Du sie missen kannst) noch einige (3 ist schon genug) auf verschiedenem Papier zur eventuellen Nutzanlegung. In Detmold verschenke ich nichts. Die Briefe an die Herren literarischen Hammel 40und Ochsen werde ich nach Frankfurt schicken, jedoch kann ich das erst dann thun, wenn ich mein gedrucktes Exemplar [GAA, Bd. V, S. 180] in der Hand habe, und sehe wie es den Messires in Geist oder Auge fällt. Dann erhältst Du die Briefe in 3 Tagen, und damit sie nicht die Buchhändlerspeculation wittern, schreibe ich hinein, ich wäre grade in Frankfurt zum Besuch. 5 Nicht umsonst spreche ich in der Shakspearo-Manie vom Eulenspiegel; mein nächstes Lustspiel soll ihn vorführen. Zwei Romane, ein kleiner und ein großer, werden auch in dem nämlichen Augenblicke vom Baume fallen, wo meine Stücke effectuiren. In der Manie spreche ich von Tiecks „Verlobten“; 10ich glaube aber die Novelle heißt „die Verlobte.“ Corrigire es, si placet. Ich habe die Manie geschrieben, ohne ein einziges Buch nachzuschlagen. Auch in Tiecks Briefe fehlt hier und da ein Komma oder ein Und. Das kannst Du auch ersetzen. Bei Gott, Du bist Doctor und 15Hebamme. Mein Eulenspiegel soll theatralisch werden, auch äußerlich etwas von einer Eule an sich haben. Berlin gebe ich noch nicht auf. Daß die Publication meiner Stücke in den Herbst fällt, ist gut, denn Gothland z. B. trägt Herbstspuren. Den Sulla, wenn das Fragment, wie ich hoffe, 20Effect macht, vollende ich diesen Winter, vor Weihnachten. Er steht schon in meinem Kopf Scene vor Scene. Marius sagt schon: „durch meiner Augen Fenster sieh't nicht mehr der Löwe, wie wohl ehedem. Er ist zu einem gelben welken Herzchen eingeschrumpft.“ Vielleicht benutze ich in Westphalen 25auch unsren lieben Pustkuchen zum Trommeln. Erfreue bald mit Antwort | | | Deinen | | Detmold den 12t Aug. | | alten, treuen Grabbe. | | 1827. | | |
30 [Adresse:]  Sr Wohlgeboren dem Herrn Buchhändler Kettembeil (Hermannsche Buchhandlung) in Frankfurt am Main. Frei. Sr Wohlgeboren dem Herrn Buchhändler Kettembeil (Hermannsche Buchhandlung) in Frankfurt am Main. Frei. |
| |


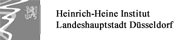


131.
H: Doppelbl. in 40; 3 S., Adresse auf S. 4.
Auf S. 4 Vermerk des Empfängers: 1827 Grabbe in Detmold den
12 Aug. Abgangsstempel: DETTMOLD 12/8 Ankunftsstempel: [nur
noch einige Buchstaben von Frankfurt sichtbar].
F: GrA
D: WBl IV 408—11, als Nr 8, eine ausgelassene Stelle S. 623
bis 624.
S. 177, Z. 39: geschrieben,] geschrieben H danach
S. 177, Z. 31 f.: die öffentlich, selbst in der Modezeitung, gegen
ihn auftreten: Der Jg. 1827 der „Allgemeinen Modenzeitung“, einer
„Zeitschrift für die gebildete Welt“, hat nicht nachgewiesen werden
können. Auch Goedekes „Grundriß“ (2. Aufl., Bd 6, 1898, S. 32 ff.)
gibt keine Auskunft.
S. 177, Z. 37: Müllner hat ihn schon tüchtig gebissen: In dem
von ihm im Jahre 1826 gegründeten „Mitternachtblatte für gebildete
Stände“. Tiecks frühe Novellen „Dichterleben“ und „Die Verlobung“
hatte Müllner anerkennend besprochen, merklich kühler den „Aufruhr
in den Cevennen“. In diese Zeit fällt ein Mißerfolg des Dramaturgen
Tieck. Dieser hatte den Ausspruch getan, daß Calderons Komödie
„Dame Kobold“ ein musterhaftes Lustspiel sei, und sich für
ihre Aufführung am Dresdener Theater eingesetzt. Das dortige Publikum
[Bd. b5, S. 526]
war aber bereits so sehr gegen Tieck eingenommen, daß es
das Stück „nicht still durchfallen ließ, sondern gegen alles Herkommen
auspochte“. (Heinrich Laube, „Das norddeutsche Theater“,
„Gesammelte Werke“ Bd 31, 1909, S. 83. Vgl. ferner den aus
Dresden von Mitte Januar datierten und mit „Guido“ unterzeichneten
Bericht in Nro 29 des „Morgenblattes“ vom 3. Februar 1826,
S. 115.) Müllner fand es verständlich, „daß einmal ein deutsches
Publikum bloß darum, weil es ein deutsches ist, also aus rein
nationalem Antriebe, gegen diejenigen universellen Kunstgärtner
sich auflehnte, welche aus dem deutschen Theatergarten einen
botanischen voll exotischer Gewächse, oder wohl gar ein Herbarium
voll getrockneter ausländischer Pflanzen zu machen“
suchen („Mitternachtblatt“ 1826, S. 165), und er nahm auch (in No 4
des „Mitternachtblattes“ vom 5. Januar 1827, S. 13—14) Partei gegen
Adolph Wagner, der mit seiner Didaskalie „Theater und Publikum“
(Leipzig 1826) Tieck zu Hilfe gekommen war. Der gegen ihn erhobene
Vorwurf, daß er einseitig die ausländische Literatur bevorzuge,
mochte Tieck veranlassen, sich darüber in der Öffentlichkeit auszusprechen.
Er tat dies in einem Aufsatze, der sich in No 4 der von
ihm herausgegebenen „Dramaturgischen Blätter“, Beilage zu No 30
der „Dresdner Morgen-Zeitung“ vom 20. Februar 1827, findet, und
den er zugleich zum Gegenangriffe benutzte. Es sei, so führte Tieck
u. a. aus, „der Ton des Tages und der schwächste Kritiker“ stimme
ihn an, „auf jene Ritterstücke, die vor mehr als dreißig Jahren das
Publikum entzückten, mit Verachtung hinabzusehen und von der
Rohheit, Wildheit und Plattheit dieser Produkte zu sprechen.“ Sei
denn aber die neuere Sekte oder Schule, welche Tragödien liefere,
etwa besser? Er wolle „jene vergessenen oder vernachlässigten Stücke
weder loben noch rechtfertigen, aber eine vergleichende, unbefangene
Critik“ werde ihnen „wenigstens den Vorzug vor den neueren Modewaaren
geben müssen. Im [Otto von] Wittelsbach [Babo's], Agnes
Bernauer, dem Thorringer [des Grafen Josef August von Törring-Guttenzell]
sei „ein Streben nach Charakter, dramatischer Kraft und
großer Leidenschaft“ nicht zu verkennen. Mit Recht könne man
„gegen die Gesinnung, den Patriotismus und das Uebertriebene und
Unnatürliche eifern“; sei dies alles schon „über das Maas und die
Schönheitslinie“ hinausgewesen, welche uns der „Götz“ gewiesen hätte,
so stünden diese „Erzeugnisse einer verirrten Kraft“ immer noch „als
Adel und Natur den ganz verwirrten Gespenstbildungen eines Müllner,
Houwald und Raupach gegenüber“. Wie habe man nicht auf die
„Räuber“ gescholten! Bedürfe es aber „wirklich einer tief gehenden
Critik, um einzusehen, daß das Grausamste in diesem Gedicht, das
Wildeste und völlig Ueberspannte nicht dennoch Milde, Humanität,
Wahrheit und Natur sey, gegen eine Schuld, Ahnfrau, Albaneserinn,
Isidor und Olga gehalten und gemessen?“ Wir stünden in diesen
Produkten, die sich fast eines allgemeinen Beifalls erfreut hätten,
„auf einem so sonderbaren Punkt roher Barbarei, daß sich in frühern
Zeiten kaum etwas Aehnliches, selbst in Paris, während der
Revolution, auf dem Theater wenigstens nicht“, gemeldet habe. Dies
sei „um so schlimmer, weil es mit einer falschen Sentimentalität,
weichlichen Empfindsamkeit und idealischer Liebe (wie diese Dichter
[Bd. b5, S. 527]
meinen) verbunden“ sei. Aus jenen bezeichneten Gedichten sei „die
unerläßliche poetische Scham und Scheu“, die den Menschen zum
Menschen mache und das Gute und Edle in ihm binde, völlig gewichen.
Werde aber diese Scheu in uns vernichtet, werde „von einem
rohen Gelüst, um den Rohen zu erschüttern, jene Gränze überschritten
“, so werde „aus der Poesie, Kunst und Tragödie ihr widerwärtiges
Gegentheil“, und entweder stelle sich „das rein Abgeschmackte
dar oder das Abscheuliche selbst“ trete uns entgegen.
Möchte man nicht fast glauben, „diese Spektakel seien für ein Nationaltheater
der Caraiben, oder von Leibeigenen selbst im wildesten
Haß gegen ihre Herren gedichtet worden?“ (Sp. 28—29.)
Durch die offenbaren Ungerechtigkeiten und Übertreibungen dieser
Replik mußte sich Müllner herausgefordert fühlen; vor allem konnte
er Tieck den „Caraiben“ nicht vergessen. So wurde er denn künftighin
nicht müde, den „dramaturgischen Großsultan von der Oberelbe
“, in längeren und kürzeren Beiträgen zum „Mitternachtblatte“,
zu verhöhnen. Angesichts der Anmaßlichkeit und Besserwisserei des
Gegners zitierte er die spöttische Travestie:
„Gott ist Göthe
Und Tieck sein Prophete“
(No 66, 24. April, S. 263), die von Tieck angewandten kritischen
Maßstäbe kehrte er gegen dessen eigene Werke, wie etwa „Karl
von Berneck“ oder den „Cevennenkrieg“ oder er beschwor die Erinnerung
an den „tapferen Ritter von La Mancha“ (No 72, 4. Mai,
S. 285—87). Jede Gelegenheit zur Vergeltung war ihm willkommen,
so die Vorrede zu Uechtritzens „Alexander und Darius“ (No 96,
15. Juni, S. 381—82) oder „Ludwig Tiecks, des Großen, jüngste
Kalender-Novelle“, nämlich „Glück giebt Verstand“ (No 100, 22.
Juni, S. 397—98). Bis in den Jahrgang 1828 hinein dauerte dieser
Kleinkrieg. (Vgl. S. 166—68, 191—92, 225—28, 229—32, 404,
770—71, 819.) Was dabei dem Dramaturgen Tieck vorgeworfen
wurde, war im Grunde stets das Gleiche: daß er in seiner Stellung
am Dresdener Hoftheater nicht für einen guten Spielplan sorge,
daß er selbst nicht zu den Proben komme, und daß er, der „Meister“
, noch immer auf ein eigenes Meisterstück für die Bühne warten
lasse. — Der Dramaturgenkrieg hat seinerzeit einiges Aufsehen
erregt. Carl Herloßsohn fügte in seine „Löschpapiere aus dem Tagebuche
eines reisenden Teufels“ (Th. [1.] Leipzig, Taubert 1827;
Th. 2. Hamburg, Hoffmann & Campe 1828) zwei Parodien der
Kapuzinerpredigt in „Wallensteins Lager“ ein, in denen er Tieck
zum Gegenstande seines Witzes machte. (Th. [1,], S. 255—58;
Th. 2, S. 231—36.) Sprecher der ersten ist Müllner selbst als Geist,
„in rosenfarbnem Costüme“; in ihr wird Tieck u. a. sein „Shakespeare
-Vergöttern und Ueber-Alles-Erheben“ vorgehalten und er ein
„Uns-Alle-Verachter“ und „Fremdlober“ gescholten. Die zweite, in
der übrigens auch Grabbe genannt wird, ist Shakespeare's Schatten
in den Mund gelegt. Dieser erscheint vor einem zahlreichen Auditorium,
dem gerade Professor N — Vorlesungen aus dem von L. Tieck
[Bd. b5, S. 528]
zu erscheinenden Werke über Shakespeare hält. Soeben ist er „im
kühnen Sprunge von der Menschlich- und Liebenswürdigkeits-Charakteristik
der Lady Macbeth zur Auslegung des Hamletschen Monologs
“ übergegangen, da wird er von dem Fremden im Schlafrocke
unterbrochen, der nun das Katheder besteigt und den Dichter mit
aller Schärfe abkanzelt als den Propheten der „Kleintiecker“, den
„Eisenfresser“, der alles wolle, alles könne und alles besser wisse.
Nachdem er genedet, wirft der Schatten dem Auditorium die auf
dem Katheder liegenden Bücher und Broschüren an die Köpfe. Eine
Dame, deren Hut à la Navarin durch den zweiten Band des Franz
Horn total zerquetscht ist, bricht in lautes Weinen aus. Der Geist
läßt noch ein künstliches Donnerwetter erschallen, dann verschwindet
er. Noch an anderer Stelle (Th. 2, S. 177) wird gegen Tieck gestichelt,
wobei auch der „Karaibe“ herhalten muß. Auf den, als
Parodie auf Schillers „Handschuh“ gedichteten „Neudeutschen Dramaturgenkrieg
auf dem Blocksberge“ in der Hamburgischen „Teufelszeitung“
ist in der Anm. zu
auf Müllner einzugehen, nahm Klingemann Tiecks „promulgirte, majestätische
Machtsprüche“ zum Anlasse, sich im dritten Bande von
„Kunst und Natur“ (Braunschweig, Meyer 1828, S. 259—72) mit
ihnen auf eine Art auseinanderzusetzen, die den neuen Dramaturgen
der Dresdener Bühne in kein günstiges Licht rückte. Vgl. 1. Anton
Kolbabek, „Adolph Müllner als Kritiker“, Dissertation Wien 1926.
[Maschinenschrift.] In ihr ist der Dramaturgenkrieg auf den S.
83—89 dargestellt. 2. Gustav Koch, „Adolph Müllner als Theaterkritiker,
Journalist und literarischer Organisator“, Emsdetten, Lechte
1939 = Die Schaubühne Bd 28, S. 97—98. Noch im Jahre 1830,
in seinem neunundzwanzigsten Briefe aus Paris, datiert vom 27sten
April, kam Friedrich von Raumer auf die Polemik zurück, begreiflicherweise
die Partei seines Freundes Tieck nehmend und voller
Entrüstung über die Haltung der jüngeren Generation. „Jahre lang“,
so schreibt er, „hat Müllner auf nichtsnutzige Weise Tieck verläumdet,
und dieser hat in großartiger Ruhe geschwiegen, wie es
ihm und seinen bejahrten Freunden gebührt. Aber die jungen
enthusiastischen Poeten und Kritiker, hat denn wohl einer den
Muth gehabt, die Pfote gegen M. herauszustrecken! In der Tasche
haben sie Schnippchen geschlagen und Tieck gesagt, sie gölten seinem
Gegner, und diesem, sie gölten dem alten, thörichten Zauberer! Man
könnte manchen malen, wie er über den d-[resdener] Altmarkt,
als positiver und negativer Korkstöpsel zugleich, von Tieck zu —
und von diesem zu jenem in gar rastloser Thätigkeit hin- und
herfliegt, bis er zuletzt in der Mitte bei den Portechaisenträgern
in ästhetische Ruhe und sein Cabinet d'aisance geräth.“ („Briefe
aus Paris und Frankreich im Jahre 1830“, Th. 1, Leipzig, Brockhaus
1831, S. 154.)
S. 177, Z. 38: Dr. Gans desgleichen: Von Dr. Eduard
G. (1798—1839), seit 1825 außerordentlicher Professor der
Rechte an der Berliner Universität, brachte der erste Jahrgang
des „Berliner Conversations-Blattes für Poesie, Literatur und
Kritik“ (1827) einen längeren Aufsatz über „Dramaturgische
Blätter nebst einem Anhange noch ungedruckter Aufsätze über das
[Bd. b5, S. 529]
Deutsche Theater und Berichten über die Englische Bühne, geschrieben
auf einer Reise im Jahre 1817 von Ludwig Tieck. Breslau 1826.
Zwei Bde. in 12mo. Im Verlage von Joseph Max und Comp.“
Der erste Artikel ist in den Nrn 39 und 40 vom 23. und 24.
Februar, der zweite in den Nrn 50 und 51 vom 10. und 12. März,
der dritte in den Nrn 59 und 60 vom 23. und 24. März enthalten.
G. vertritt darin eine Meinung, die derjenigen Tiecks gerade entgegengesetzt
ist. Im ersten Artikel wird der Standpunkt bestimmt,
dem Tiecks Kritik angehöre. G. unterscheidet zwei Klassen von
Kritikern: die philosophischen und die Reflexionskritiker, und er
rechnet Tieck zu dieser. Damit sei die Subjektivität auf den Thron
gesetzt und regiere. Eine solche subjektive Weise mache aber die
Kritik von der jeweiligen Stimmung abhängig und führe zu einem
ungerechten Wechsel der Maßstäbe. Wolle man das, was dieser
Kritik empirischer Weise zu Grunde liege, angeben, so dürfe man
mit Gewißheit sagen, „die vorliegenden Dramaturgischen Blätter,
seyen einer keuschen und monogamischen Ehe entsprungen, nämlich
der Ehe eines Seufzers und einer Bewunderung. Es ist
der Seufzer über die große Zeit einer entschwundenen Bühne, welcher
sich mit der Bewunderung eines einzigen ungeheuren alles absorbirenden
Dichters vermählt hat. Durch alle Gesichtszüge dieser
dramaturgischen Blätter zieht die Erinnerung an diese Urheber, und
mitten in der ruhigen Betrachtung irgend eines Gegenstandes begiebt
es sich daß oft elegischer Weise, der große Schmerz die Betrachtung
übertrifft, und nun selbständig für sich fortgeht. Es ist
die geheime Sehnsucht die alle Theile des Buches durchzieht und
ihnen ihr Lebensprinzip ertheilt“ (S. 158). Den folgenden Partien
fällt nun die Aufgabe zu, auf die Besonderheit des Inhalts der
„Dramaturgischen Blätter“ einzugehen. Jedoch beschränkt sich der
Verf. darauf, Tiecks „Bemerkungen über einige Charaktere im
Hamlet und über die Art, wie diese auf der Bühne dargestellt
werden könnten“ (Bd 2, S. 58—133), aufs schonungsloseste zu zerpflücken.
S. 178, Z. 3: Thue wie Du willst: Kettembeil hat den Namen
Tiecks in den Entwurf der Anzeige (in Grabbes vorangehendem
Briefe) eingesetzt, so daß er sich nun auch in deren Drucken
(„Fürstlich Lippisches Intelligenzblatt“ 1827, S. 340, und Hallische
„Allgemeine Literatur-Zeitung“ Nr 4, Januar 1828, Sp. 29) findet.
S. 179, Z. 33 f.: Köchy (der Devrients Tochter jetzt geheirathet
hat): Nach einem vom Braunschweigischen Stadtarchiv hergestellten
Auszuge aus dem Kirchenbuche der St. Michaelis-Gemeinde zu
Braunschweig (Trauungen 1835—3. 1. 1850, S. 250) sind am 18. Mai
1843 kopuliert worden: „Carl Georg Heinrich Eduard Köchy (geb.
d. 6. Octbr. 1799 zu St. Katharinen) Dr. phil. und Intendantur-Rath
hieselbst, ehelicher Sohn des hiesigen Geheimen Hofrathes und Professors
Johann Carl Theodor Köchy, und dessen verstorbener Ehegattinn
Elisabeth Henriette Juliane geborne Müller“ und „Jungfrau
Marie Auguste Eleonore Sophie von Griesheim eheliche Tochter
des hiesigen herzogl. Braunschw. Majors Albert von Griesheim und
dessen Ehegattinn Friederike Dorothee geborne von der Asseburg.
(Die Braut ist geboren den 11. Mai 1817 zu St. Katharinen.)“ Da
[Bd. b5, S. 530]
nach fernerer Mitteilung des genannten Archivs Köchy in diesem
Eintrage nicht, wie üblich, als Witwer bezeichnet ist, so ist ein
früherer Eheschluß mit einer Tochter Devrients nicht anzunehmen.
Die von Grabbe erwähnte Verheiratung könnte sich auf die Trauung
des Bruders Karl Köchys, den Ökonomen Christian Philipp
Eduard K., beziehen, der im Januar 1827 Bertha Therese Henriette
Agathe Philippine Bruns, die Tochter des in Elze wohnhaften
Oberamtmanns Moritz B. und dessen Ehefrau Sophie, geb. Klenze,
geheiratet hat.
S. 179, Z. 33: Devrients Tochter: Emilie (1808—1857). Sie war,
da ihre Mutter, Devrients erste Gattin, eine Tochter des seiner
Zeit berühmten Dekorationsmalers Neefe, bei der Geburt des Kindes
gestorben war, in einer Pension erzogen und 1821 zu Klingemann
nach Braunschweig gebracht worden, um zur Schauspielerin erzogen
zu werden. Sie debütierte 1824 mit dem Erfolge, daß sie auf drei
Jahre engagiert wurde. Weniger glücklich war sie 1825 bei einem
Gastspiele am Berliner Hoftheater. Ihrem Vater mißfiel sie höchlich;
er fand sie naturlos. Später fand sie Engagements in Danzig, in
Königsberg, wo sie einen Schauspieler namens Höffert heiratete, in
Stettin und schließlich an dem kleinen Schweriner Hoftheater.
Nachdem ihre Tochter Elise als jugendliche Liebhaberin die Bühne
betreten hatte, zog sich die Mutter ganz vom Theater zurück. Der
Tod der Tochter, die, 26 Jahre alt, am 5. Juli 1855 starb, brachte
die Mutter ins Elend. Am 25. November 1857 ist sie in Siebenbürgen
gestorben. (Vgl. Julius Bab, „Die Devrients. Geschichte einer
deutschen Theaterfamilie.“ Berlin, Stilke 1932, S. 56—57.)
S. 180, Z. 9—11: In der Manie spreche ich [usw.]: Tiecks
Novelle heißt weder „Die Verlobten“ noch „Die Verlobte“, sondern
„Die Verlobung“. Sie ist zuerst im „Berlinischen Taschenkalender“
für 1823 erschienen. Siehe
dazu (
S. 180, Z. 11: si placet: wenn's gefällt.
S. 180, Z. 24 f.: Vieleicht benutze ich in Westphalen auch unsren
lieben Pustkuchen zum Trommeln: P. gab damals die in Herford
verlegte „Westphalia, eine Zeitschrift für unbefangene Leser aus
allen Ständen“ (1822—25 unter dem Titel: „Westphalen und Rheinland,
eine ausschließlich diesen Ländern gewidmete Zeitschrift für
unbefangene Leser aus allen Ständen“) heraus.