| Nr. 619, siehe GAA, Bd. VI, S. 250 | 18. Juni 1835 |  | | Christian Dietrich Grabbe (Düsseldorf) an Carl Georg Schreiner (Düsseldorf) | | Brief | | | | Vorangehend:  | Nachfolgend:  |
|  Nun wollen wir an die Journale. Das Modeluder: Sobiesky ist schlecht. p. 300 John Kemble und Claremont dumm. 35 Chamisso ist, mein' ich, ein Normanne. Doppelkupfer 19. Er sieht abscheulich aus. Dießmal fader als sonst, was viel sagt. Nun wollen wir an die Journale. Das Modeluder: Sobiesky ist schlecht. p. 300 John Kemble und Claremont dumm. 35 Chamisso ist, mein' ich, ein Normanne. Doppelkupfer 19. Er sieht abscheulich aus. Dießmal fader als sonst, was viel sagt. [GAA, Bd. VI, S. 251] Elegante: Die Brunn war taub und hat einmal die Melonen für Banditen gehalten. Das lassen sie aus. Die Briefe aus Finnland sind gut, man kann sie ohne Schaden 5überschlagen. So'n Kerl in dem sonderbaren Fels- und Sumpflande und schildert's wie nichts. p. 355. sitzt ein Kerl auf der Terrasse Pilati in Jerusalem, und Pilatus hat weder in Jerusalem gewohnt, noch liegt das jetzige Jerusalem auf der alten Stelle. 10nr. 94. Rec. hat schlechte Ohren. Statt Vöglein mußte er was von Vögeln hören. Keine Sauglocke, wenn man Sau Sau nennt, sonst beleidigt man die Wahrheit. Freimüthige. p. 360 noch der Hübnerische „Großtürke“! 15 Nänny sollt's Maul halten. p. 179 ist das Schloß Foz, p. 180 [richtig: 181] wird's vergeblich attaquirt, was merkwürdig für den Natur- beobachter und Menschenkenner.  Phoenix. p. 367. Soult ist gar nicht bei Belle Alliançe 20gewesen. p. 375. Ist Tell deutsche Musik, so ist Mozarts Don Juan kauderwelsche. O Rüppel, Frankfurter Puppe, danke Gott, daß der Nil dich nicht beschrieben. Meinst du, du bekämst die Weisheit 25in der Ferne? Dann bist du nicht weit genug gelaufen, Krüppel. Sonst nichts. Morgenbl. p. 415: „— Weil im Sanskrit die Katze mordjaroh heißt, so will man das deutsche Marder davon ableiten, wovon 30ich aber keinen Grund einsehe.“ Ich auch nicht. — Macht der Kerl nr. 106 das Wort Feho! Daß Vieh Vermögen hieß, weiß man ja aus dem englischen fee besser. p. 422 Urwelt von einem Ur abgeleitet, heißt Ochswelt. Nach 35dem Verf. scheint's auch so. Irving lügt. Ein wildes Pferd sieht schlechter aus als ein dressirtes. Die Tournure des Pferdes hat der Mensch gemacht. Ein Esel sagt's anders. Ich kenne wilde Pferde. In dem Mancherlei über Pflanzen- u. Thierkunde ist jede 40Zeile beweinenswerth erbärmlich. Phoenix. p. 367. Soult ist gar nicht bei Belle Alliançe 20gewesen. p. 375. Ist Tell deutsche Musik, so ist Mozarts Don Juan kauderwelsche. O Rüppel, Frankfurter Puppe, danke Gott, daß der Nil dich nicht beschrieben. Meinst du, du bekämst die Weisheit 25in der Ferne? Dann bist du nicht weit genug gelaufen, Krüppel. Sonst nichts. Morgenbl. p. 415: „— Weil im Sanskrit die Katze mordjaroh heißt, so will man das deutsche Marder davon ableiten, wovon 30ich aber keinen Grund einsehe.“ Ich auch nicht. — Macht der Kerl nr. 106 das Wort Feho! Daß Vieh Vermögen hieß, weiß man ja aus dem englischen fee besser. p. 422 Urwelt von einem Ur abgeleitet, heißt Ochswelt. Nach 35dem Verf. scheint's auch so. Irving lügt. Ein wildes Pferd sieht schlechter aus als ein dressirtes. Die Tournure des Pferdes hat der Mensch gemacht. Ein Esel sagt's anders. Ich kenne wilde Pferde. In dem Mancherlei über Pflanzen- u. Thierkunde ist jede 40Zeile beweinenswerth erbärmlich. [GAA, Bd. VI, S. 252]  Narren, suchen sie in weiter Ferne, um zu beweisen, „ellen“ habe „stark“ geheißen. Die Helden, die nicht merken, daß Held davon abstammt. Der Missionsber. aus Siam ist abscheulich. Er nennt das 5Land gar: groß. Wenn, wie der Narr von Mission. sagt, die Siamesen Schweine in die Kirchen schicken, begreif' ich nicht, wie sie ihn übersehen haben. Sie lieben ja das Weiße, weil bei ihnen alles gelb ist, und dieser Religionsaffe, der dennoch die Verehrung des weißen Elephanten nicht begreift, muß 10dort gelb angekommen seyn, also eine Merkwürdigkeit. p. 446 wird die Politik keusch genannt. p. 451 ist die Idee vom Eindringen in die Erde auch die meinige. Da stehen sie still, wenn sie ein bischen Gold finden, und versuchen nicht die Tiefe, und darin etwas 15Anderes zu finden. Unter unsren Füßen liegt das Luder, aber wir bleiben Läuse. Die Macht die zuerst alles auf Untersuchung des Erdinneren verwendet, wird, sey sie auch klein, Herrin der Welt. Literaturbl. Nach p. 190 oben hab' ich Pückelchen im 20Bettinchen richtig errathen. Gleich unter den Versen sieht man's. pag. 180 wird die weltbekannte Eroberungsgeschichte Antiochiens zu einer neuen getauft! Wo ist Galettis Compendium? 25 Narren, suchen sie in weiter Ferne, um zu beweisen, „ellen“ habe „stark“ geheißen. Die Helden, die nicht merken, daß Held davon abstammt. Der Missionsber. aus Siam ist abscheulich. Er nennt das 5Land gar: groß. Wenn, wie der Narr von Mission. sagt, die Siamesen Schweine in die Kirchen schicken, begreif' ich nicht, wie sie ihn übersehen haben. Sie lieben ja das Weiße, weil bei ihnen alles gelb ist, und dieser Religionsaffe, der dennoch die Verehrung des weißen Elephanten nicht begreift, muß 10dort gelb angekommen seyn, also eine Merkwürdigkeit. p. 446 wird die Politik keusch genannt. p. 451 ist die Idee vom Eindringen in die Erde auch die meinige. Da stehen sie still, wenn sie ein bischen Gold finden, und versuchen nicht die Tiefe, und darin etwas 15Anderes zu finden. Unter unsren Füßen liegt das Luder, aber wir bleiben Läuse. Die Macht die zuerst alles auf Untersuchung des Erdinneren verwendet, wird, sey sie auch klein, Herrin der Welt. Literaturbl. Nach p. 190 oben hab' ich Pückelchen im 20Bettinchen richtig errathen. Gleich unter den Versen sieht man's. pag. 180 wird die weltbekannte Eroberungsgeschichte Antiochiens zu einer neuen getauft! Wo ist Galettis Compendium? 25 Alles über den Pückler ist widerlich. Er ist ein talentvoller Vornehmthuer, und dadurch ruinirt er sich selbst. Kunstbl. Gräßlich dießmal. Ich meine, Herodot erwähnte schon das Memnon-Tönen. Ist's aber auch nicht, der Memnon -Aufsatz ist ekelhaft. Alles Licht würde ausgehen, 30brauchte man ihn zu Fidibus, so dunkel-dumm ist er. Intellbl. p. 55. „Meine Erfahrungen in der höheren Schafzucht. “ Hoffentlich hat Hr. Elsner sich nicht dabei vergessen. Auf dieser Seite ist auch sonst viel Vieh. nr. 15 Wilckes Templergeschichte wird trefflich seyn. Er 35ist nicht umsonst verrückt gewesen. Maltens Weltkunde. Ach das Elsaß! Es gehört uns! 4ter Thl. p. 7. Unsere Sache, es zurückzuerobern, Herr Verfasser. Russen und Engländer lassen in Asien um die Wette reisen. 40'S gibt bald 'nen großen Zankapfel. Wir fressen mit daran. Alles über den Pückler ist widerlich. Er ist ein talentvoller Vornehmthuer, und dadurch ruinirt er sich selbst. Kunstbl. Gräßlich dießmal. Ich meine, Herodot erwähnte schon das Memnon-Tönen. Ist's aber auch nicht, der Memnon -Aufsatz ist ekelhaft. Alles Licht würde ausgehen, 30brauchte man ihn zu Fidibus, so dunkel-dumm ist er. Intellbl. p. 55. „Meine Erfahrungen in der höheren Schafzucht. “ Hoffentlich hat Hr. Elsner sich nicht dabei vergessen. Auf dieser Seite ist auch sonst viel Vieh. nr. 15 Wilckes Templergeschichte wird trefflich seyn. Er 35ist nicht umsonst verrückt gewesen. Maltens Weltkunde. Ach das Elsaß! Es gehört uns! 4ter Thl. p. 7. Unsere Sache, es zurückzuerobern, Herr Verfasser. Russen und Engländer lassen in Asien um die Wette reisen. 40'S gibt bald 'nen großen Zankapfel. Wir fressen mit daran. [GAA, Bd. VI, S. 253] p. 59. ect. Das dummste Zeug. Zoten dabei. Der Kerl hat's Schruppen ausgelassen. — Nordamerika wird Monarchie. Demokratie ist's ja schon. Es wird sich in 3 Theile theilen, ist's mehr bevölkert. Missisippi, 5Lorenz- und Delaware, und Küste der Südsee. — Das Gepack von Schreibern riecht nichts.  p. 124. Das Unthier! Japans Landwirthschaft ist die erste der Welt. In der Gärtnerei stehen sie den Chinesen nach und nur deshalb, weil sie zu wenig Platz haben. 10 Der neue Leonidas bezeichnet recht die französische Windbeutelei. Man sollte das Volk nur an der Kehle packen. Der Aufs. über die Bibliotheken in Spanien ist erbärmlich. Dort sitzen Bücher, aber nicht auf den Fahrwegen. In dem Buch sitzt Zschockke, das Würmlein. 15Miscellen. p. 166. Daß der verlaufene d'Haussetz einige Beweggründe hat, daß die Fürsten nicht immer Unrecht haben, glaub' ich. — Es ist auch so, aber warum so dumm das, was jeder Vernünftige weiß, auseinandersetzen? p. 169. „Kann man es der Regierung übel nehmen, daß sie 20keine Personen anstellt, welche ihr nicht dienen wollen?“ Teufel, nein. Der albernen Frage! Die Lebensversicherung zu Gotha, der meine Frau 300 rthlr. anbot, baar, wollte mich doch nicht. Ausland. 122. Rjäsian ist keine neue, es ist eine alte 25Stadt. Fürsten residirten darin. Lamartine kann zum Teufel gehen, denn mit dem lieben Gott hat er sich schon zuviel zu thun gemacht. Seine Reise hat er recht matt beschrieben. Chateaubr. ist besser. Wie's mit Peter und Michel ist, weiß man ohnehin. Michel 30ist dumm, hat aber Recht. p. 124. Das Unthier! Japans Landwirthschaft ist die erste der Welt. In der Gärtnerei stehen sie den Chinesen nach und nur deshalb, weil sie zu wenig Platz haben. 10 Der neue Leonidas bezeichnet recht die französische Windbeutelei. Man sollte das Volk nur an der Kehle packen. Der Aufs. über die Bibliotheken in Spanien ist erbärmlich. Dort sitzen Bücher, aber nicht auf den Fahrwegen. In dem Buch sitzt Zschockke, das Würmlein. 15Miscellen. p. 166. Daß der verlaufene d'Haussetz einige Beweggründe hat, daß die Fürsten nicht immer Unrecht haben, glaub' ich. — Es ist auch so, aber warum so dumm das, was jeder Vernünftige weiß, auseinandersetzen? p. 169. „Kann man es der Regierung übel nehmen, daß sie 20keine Personen anstellt, welche ihr nicht dienen wollen?“ Teufel, nein. Der albernen Frage! Die Lebensversicherung zu Gotha, der meine Frau 300 rthlr. anbot, baar, wollte mich doch nicht. Ausland. 122. Rjäsian ist keine neue, es ist eine alte 25Stadt. Fürsten residirten darin. Lamartine kann zum Teufel gehen, denn mit dem lieben Gott hat er sich schon zuviel zu thun gemacht. Seine Reise hat er recht matt beschrieben. Chateaubr. ist besser. Wie's mit Peter und Michel ist, weiß man ohnehin. Michel 30ist dumm, hat aber Recht.  Rehberg thut's Maul auf zur Weltverbesserung, und es kommt Metaphysik heraus. Da war Almendingen ein anderer Kerl. Rehberg thut's Maul auf zur Weltverbesserung, und es kommt Metaphysik heraus. Da war Almendingen ein anderer Kerl. | Der philosophirte doch, wenn er's sagte. | | | | Waterloo, Belle-Alliançe und | | Ihr | | Mont Saint Jean heut vor zwanzig | | Grabbe. | | Jahren [18. Juni 1835.] | | |
Die Journale beian retour. [Adresse:] Sr Wohlgeboren dem Herrn Buchhändler Schreiner. Mit 9 Journalen. [GAA, Bd. VI, S. 254] |
| |


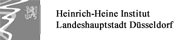


619.
H: 1 Doppelbl., 1 Bl. in 20; 4⅖ S., Adresse auf S. 6.
F: GrA
T: WGr IV 468—69, als Nr 227. (Der Inhalt des einzelnen Blattes,
von den Worten: „p. 124. Das Unthier!“ an.)
S. 250, Z. 36: aus.] aus H
S. 251, Z. 28: heißt] heiß H
S. 251, Z. 37: Tournure] Tourure H
S. 252, Z. 19: Literaturbl.] Literatnrbl H
S. 252, Z. 31: Intellbl.] Intellbl H
S. 250, Z. 33: Das Modeluder [usw.]: „Moden-Zeitung“
Nr 19—22: „Galerie berühmter Männer. I. Johann Sobieski.“
S. 250, Z. 34: p. 300 John Kemble [usw.]: Ebenda Nr 19. Sp.
300. Die erste der „Miscellen“ lautet:
„(John Kemble und Claremont.) John Kemble konnte
bisweilen scherzen, und Claremont rühmte sich gewöhnlich der
Triumphe, welche er in den Provincialstädten errungen haben wollte.
Einst erzählte er von einem Unfalle, der ihm begegnet sey, als
er in Rochester Richard zum zweiten Male gespielt habe. 'Wie?' fiel
ihm Kemble sogleich in die Rede, 'die Leute ließen Sie den Richard
in einer Stadt zweimal spielen?'“
[Bd. b6, S. 597]
John Philip Kemble (1757—1823) war einer der bedeutendsten
englischen Schauspieler. — Claremont: Bühnenname des im Jahre
1832 gestorbenen englischen Schauspielers William Cleaver, der aber
nur in kleineren Rollen aufgetreten ist. (Auskunft von Miss Sybil
Rosenfeld von der Society for Theatre Research in London.)
S. 250, Z. 35 f.: Chamisso ist, mein' ich [usw.]: Grabbe ist im
Irrtum: die Familie Chamissos gehört zum lothringischen Uradel;
nach der Lage seines Stammschlosses aber ist er Champenois.
S. 251, Z. 1—3: Elegante: Die Brunn war taub [usw.]:
„Zeitung für die elegante Welt“ Nr 84—86. 30. April bis 2. Mai:
„Friederike Bruun. Gestorben den 26. März 1835 in Kopenhagen.
[Unterz.:] H.v.G.“ Es sind — da die äußeren Umrisse des Daseins
dieser ausgezeichneten Frau als allgemein bekannt vorausgesetzt werden
dürften — einige Nachrichten über ihr häusliches Leben und ihre
letzten Tage. Im Anfang (S. 335) ist von ihrer langjährigen Taubheit
die Rede.
Die angebliche Verwechselung von Melonen mit Räubern hat sich
in den Schilderungen der Dichterin von ihren Reisen in südliche
Gegenden („Prosaische Schriften“, Bd 1—4, Zürich 1799—1801;
„Episoden auf Reisen“, Bd 1—4, Zürich, Bd 3 Mannheim, Bd 4
Pesth 1808 bis 18; „Römisches Leben“, Th. 1. 2, Leipzig 1833) nicht
nachweisen lassen. Auch im Müchler'schen „Anekdotenalmanache“,
von dem allerdings keine lückenlose Reihe vorgelegen hat, war eine
anekdotenhafte Behandlung des fraglichen Erlebnisses nicht zu finden.
S. 251, Z. 4—6: Die Briefe aus Finnland [usw.]: Ebenda. Vgl.
die Anm. zu
daß es eine Frau ist — erzählt in diesen Briefen, soweit sie den
Mai-Nummern angehören, von Besuchen bei einigen Freunden in
Wyburg, der Besichtigung einer Spiegelfabrik, ländlichen Belustigungen,
sowie der Jagd auf Wölfe und Bären. Über das „sonderbare
Fels- und Sumpfland“ zu sprechen ist dabei keine unbedingte Veranlassung.
S. 251, Z. 7—9: p. 355. sitzt der Kerl [usw.]: Ebenda Nr 89.
7. Mai: „Panorama von Jerusalem.“ Der kleine Aufsatz beginnt:
„Am 30. März ward in London ein Panorama von Jerusalem eröffnet,
[...] Das Gemälde ist von der Terrasse eines Hauses aufgenommen,
welches früher der Palast des Pontius Pilatus war und
jetzt vom Aga, oder Gouverneur, bewohnt wird.“ — Grabbes Bemerkung
zur alten Topographie Jerusalems rührt an ein Problem,
dessen Kompliziertheit mit so simpler Fragestellung nicht im entferntesten
erschöpft ist; das noch heute, wegen der Unmöglichkeit
umfassender Ausgrabungen, der Forschung eine Menge schwieriger
und einstweilen unlösbarer Aufgaben stellt.
S. 251, Z. 10—12: nr. 94. Rec. hat schlechte Ohren [usw.]: Ebenda
Nr 94—95. 14. u. 15. Mai: „Göthe's Monument.“ Eine Probe
aus dem dritten Bande von „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“,
der eine kurze Einleitung A.[ugust] v. B.[inzers] vorausgeht. Diese
beginnt folgendermaßen: „Es war ein schöner Herbstmorgen! Die
Vöglein zwitscherten so heimlich vor meinem Fenster, als wollten
sie mich zu sich locken, mich mit ihnen des Lebens zu freuen.“ (S.
[Bd. b6, S. 598]
373.) In derselben Spalte kommen dann die zwitschernden Vöglein
noch einmal vor.
S. 251, Z. 13 f.: Freimüthige. p. 360 noch der Hübnerische
[usw.]: „Der Freimüthige“ Nr 89. 5. Mai. S. 360: In der „Revue
der Tagesgeschichte“ steht folgende Notiz: „In der Großtürkei
wird von Obrigkeitswegen das Tabackrauchen für unanständig
erklärt und den Beamten bei allen öffentlichen Verhandlungen
untersagt.“ — „Großtürke“ ist die Bezeichnung für den türkischen
Sultan; was aber Grabbe mit dem „Hübnerischen“ Großtürken meint,
kann nicht erklärt werden. Es liegt nahe, an den Pädagogen Johann
Hübner (1668—1731) zu denken, der sich 1691 für die Fächer der
Geschichte und Geopraphie in Leipzig habilitierte, drei Jahre später
Rektor der Schule in Merseburg wurde und als Rektor des Johanneums
in Hamburg gestorben ist; jedoch ist in den wichtigsten seiner,
zu damaliger Zeit weitverbreiteten Werke die fragliche Bezeichnung
nicht zu finden. (Es sind: 1. die „Kurtzen Fragen aus der Neuen
und Alten Geographie“. Leipzig, Gleditsch 1714; 2. die „Kurtzen
Fragen aus der Politischen Historia Biß auf gegenwärtige Zeit continuiret,
Und mit einer nützlichen Einleitung vor Die Anfänger“.
Th. 1—9. [Leipzig,] Gleditsch 1707; 3. „Kurtze Einleitung Zur
Politischen Historia, Den Anfängern zum besten aus Allen neun
Theilen zusammen gezogen.“ Th. 10. [Leipzig,] Gleditsch 1707;
4. „Kurtze Fragen aus der Politischen Historia bis auf gegenwärtige
Zeit fortgesetzt“. Th. 1. Neue Aufl. [Leipzig,] Gleditsch 1744;
5. „Neuvermehrtes und verbessertes Reales Staats-Zeitungs- und
Conversations-Lexicon“. Die allerneueste Aufl. Regensburg u. Wien,
Bader 1765.) Nur der Bezeichnung „Groß-Sultan“ begegnet man hin
und wieder, z. B. in dem unter Nr 4 aufgeführten Werke, S. 655,
660 u. 680.
S. 251, Z. 15: Nänny sollt's Maul halten: Ebenda Nr 90. 7. Mai.
S. 363:
Ernst und Scherz.
Daß wir so wenig lernen,
Deß haben wir die Schuld,
Die Wahrheit auszukernen,
Fehlt's immer an Geduld,
Im Prüfen und im Sichten
Sind wir nie streng genug,
Und will's im Kopfe lichten,
Umwölkt uns Selbstbetrug.
Sprüche von J.[ohann] C.[onrad] Nänny.
Auch in früheren Nummern des „Freimüthigen“ stehen unter der
gleichen Überschrift Sprüche Nänny's.
S. 251, Z. 16—18: p. 179 das Schloß Foz [usw.]: Nicht im
„Freimüthigen“, sondern in der „Minerva“ findet sich Bd 174 (vom
Mai), S. 177—268 der folgende Beitrag: „Aus dem Tagebuche eines
Französischen Officiers im Dienste des Don Miguel während der
Feldzüge [in Portugal] in den Jahren 1833 und 1834“. Darin wird
S. 179 berichtet, daß Truppen Don Pedros, nach dessen Landung
an der Küste von Portugal, das verlassene Schloß Foz besetzen,
[Bd. b6, S. 599]
S. 181 (nicht S. 180), am Beginn des Abschnitts, daß die Anhänger
Don Miguels einen vergeblichen Angriff darauf machen.
S. 251, Z. 19 f.: Phoenix. p. 367. Soult ist gar nicht
[usw.]: „Phönix“ Nr 92—93. 17. u. 18. April: „Der Pariser Salon
im Jahre 1835. Von Ed.[uard] Kolloff. Vierter Artikel.“ Darin
S. 367 die Beschreibung des Gemäldes „Die Schlacht bei Waterloo“
von Stauben (falsch statt Carl Steuben). In diesem Artikel heißt es:
„Mehrere Generäle und Offiziere werfen sich ihm [d. i. Napoleon,
der sich in das dichteste Kampfgetümmel stürzen will] entgegen und
suchen ihn von seinem Vorhaben abzubringen; der Marschall Soult
und die Generäle Gourgaud und Drouot bitten flehentlich den
Kaiser, sich zu schonen.“ — Grabbe ist im Irrtum; sowohl bei Ligny
wie bei Waterloo (Belle-Alliance) hat sich Marschall Soult an des
Kaisers Seite befunden.
S. 251, Z. 21 f.: p. 375. Ist Tell deutsche Musik [usw.]: Ebenda
Nr 94—95. 20. [falsch für 21.] u. 22. April: „Musik in Frankfurt.
Revue des Monats April. [unterz.:] 7 [= Karl Gollmick].“ Das
Referat beginnt mit der Besprechung von Rossinis „Tell“. Darin,
nahe dem Anfange (S. 375), der Satz: „Wir hören hier eine kernhaft
deutsche und charakteristische Musik, aus einem Guß.“
S. 251, Z. 23—25: O Rüppel, Frankfurter Puppe [usw.]: Ebenda
Nr 100. 28. April. S. 400: Kurze, lobende Rezension der zwei
ersten Lieferungen der Fortsetzung des von Dr. Eduard Rüppell
herausgegebenen zoologischen Atlasses zu dessen Reise im nördlichen
Afrika (in Kommission bei S. Schmerber in Frankfurt am
Main). Das Werk enthält nur Abbildungen und Beschreibungen von
solchen Tieren, die den Naturforschern bis dahin unbekannt gewesen
und von Rüppell auf seinen abessinischen Reisen entdeckt worden
waren. — Rüppell (1794—1884), der aus Frankfurt stammte, unternahm
1817 eine Reise nach Ägypten und zum Sinai, über die
er in den „Fundgruben des Orients“, hrsg. von Hammer, Bd. 5
(Wien 1818) berichtete. Er durchwanderte sodann in den Jahren
1822 bis 27 Nubien, Sennar, Kordofan und Arabien. Diese erste
Entdeckungsreise galt zu einem guten Teile der Erforschung des
Niles; er gab Rechenschaft über sie in seinem, 1829 (bei Wilmans
in Frankfurt a. M.) erschienenen Werke „Reisen in Nubien, Kordofan
und dem peträischen Arabien vorzüglich in geographisch-statistischer
Hinsicht“. Darin sind mehrere Kapitel der Beschreibung des
Nils und der angrenzenden Provinzen gewidmet.
S. 251, Z. 27—31: Morgenbl. p. 415: — Weil im Sanskrit
[usw.]: „Morgenblatt“ Nr 104—10. 1.—8. Mai: „Mancherlei über
die Pflanzen- und Thierwelt im alten und neuen Deutschland.
Zweiter Artikel.“ Von G. Zimmermann 1. Der zitierte Satz bildet
den Schluß des in Nr 104 stehenden Teils. — Zimmermann und
Grabbe haben recht behalten mit ihrer Verwerfung dieser Etymologie,
die den schon damals bekannten Gesetzen der Lautverschiebung
widerspricht.
S. 251, Z. 32 f.: — Macht der Kerl nr. 106 [usw.]: Die zweite
Fortsetzung des in der vorhergehenden Anmerkung genannten Artikels
in Nr 106 (S. 421—23) beginnt mit folgendem Satze: „Das
[Bd. b6, S. 600]
Rindvieh war, nach Tacitus, klein und unansehnlich; indessen
bestand ein großer Theil des Reichthums in Rind- und andern
Viehheerden; daher im ältern Deutsch Feho selbst für Vermögen
steht.“ — Grabbes Einwand gegen das vermeintlich hypothetische
'feho' ist unberechtigt, denn das Wort ist in der Tat im Althochdeutschen
belegt.
S. 251, Z. 33—35: p. 422 Urwelt von einem Ur abgeleitet
[usw.]: Auf der folgenden Seite kommt der Verfasser auf den
Auerochsen oder Ur zu sprechen und behandelt zu Beginn der zweiten
Spalte die Etymologie des Wortes. Er zitiert Dietrich von Stade,
der in seiner „Erklärung etlicher deutscher Wörter in Lutheri Bibelübersetzung
“ bemerkt habe, ur bedeute ursprünglich, daneben
aber auch wild, und er fügt hinzu: „Auch im Schwedischen
hat die Partikel ur den Begriff des Anfangs, was wir gleich in
unserem 'Urwelt' finden“. — Die beiden Worte 'Ur' und 'Urwelt'
haben in der Tat etymologisch nichts miteinander gemein.
S. 251, Z. 36—38: Irving lügt [usw.]: Ebenda Nr 105—25. 2.—
26. Mai: „Die Prärien. Nach Washington Irving.“ Aus dem in
London erschienenen neuen Buche Irvings, betitelt: „A tour on the
prairies, by the Author of the sketch-book“ werden einige Szenen
übersetzt; als zweite: „Das wilde Pferd“ in Nr 107—08 (=, mehrfach
gekürzt, S. 164—67 in chapter XIX, S. 170—74 u. S. 177—81
in chapter XX; =, gekürzt und mit mannigfachen Abweichungen:
Washington Irving, „Ausflug auf die Prärien zwischen dem Arkansas
und Red-river.“ Stuttgart u. Tübingen, Cotta 1835. S. 68—74.)
Irving schildert erst die Begegnung mit einem wilden Pferde, dann
Fang und Zähmung eines Füllens, und mehrfach spricht er dabei
mit Begeisterung von der Schönheit des Tieres im Naturzustande,
dem er voll Mitleids den der Zähmung und Fron gegenüberstellt:
„heute ein Fürst der Prairien, morgen ein Packpferd!“ (S. 431.)
Grabbes Bemerkung ist aber zweifellos vor allem durch eine Stelle
angeregt, die sich gleich auf der ersten Seite findet und so lautet:
„Als es uns gewahr wurde, hielt es rasch an, betrachtete uns einen
Augenblick mit sichtbarem Erstaunen, warf dann den Kopf in die
Höhe und trabte, mit flatternder Mähne und Schweif, zierlich von
dannen, wobei es jezt über die eine, dann über die andere Schulter
nach uns umblickte. Nachdem es durch einen Streifen von Dickicht
gesezt, der einer Hecke gleich sah, hielt es im freien Feld dahinter
an, sah mit schöner Haltung des Nacken noch einmal um, zog die
Luft in die Nüstern, warf wieder den Kopf hinauf, sezte sich in
Galopp und verschwand im Wald. Zum erstenmale sah ich da ein
Pferd in seiner natürlichen Freiheit, seinem angebornen Adel. Welch
ein Kontrast mit dem armen, verdorbenen, gezäumten, geschirrten,
gezügelten Schlachtopfer des Luxus, der Launen und der Habsucht
in unsern Städten!“ — Ich kenne wilde Pferde: Dazu hatte Grabbe
Gelegenheit durch das damals noch existierende, dem Fürsten zur
Lippe gehörende Senner-Gestüt, das einzige halbwilde Gestüt
Deutschlands, dessen Pferde, von orientalischem Typus, mittelgroß
und abgehärtet, völlig sich selbst überlassen waren und Sommers
wie Winters im Freien blieben.
S. 251, Z. 39 — S. 252, Z. 3: In dem Mancherlei über Pflanzen
- u. Thierkunde [usw.]: In Nr 107 (S. 426—27) wird das „Man-
[Bd. b6, S. 601]
cherlei über die Pflanzen- und Thierwelt im alten und neuen
Deutschland“ fortgesetzt. S. 427 spricht Zimmermann vom Ellen
und der Etymologie des Wortes. Er weist zwei andere Erklärungsversuche
zurück und leitet dann das deutsche Wort „vom alten
ellen, gothisch ailan, d.i. Stärke, Kraft, her, (Nibelungenlied, wo
auch ellensreich, ellenhaft) wovon, nach Einigen, auch Helfen, Held,
ja sogar Hellenen abstammen soll! Auffallend stimmt ellen, Stärke,
zu dem griechischen Wort alke, was dasselbe bedeutet.“ Das Wort
'Held' wird also gerade mit 'ellen' (ahd. 'elljan', Eifer, Kampfeifer,
Mut, Tapferkeit) in Verbindung gebracht, ein Verfahren, von
dem sich freilich Zimmermann, und zwar mit Recht, fernhält; denn
dies Wort ist nicht die Wurzel von jenem. Ebensowenig aber geht
'Ellen' richtiger 'Elend', 'Elentier') darauf zurück.
S. 252, Z. 4—10: Der Missionsber. aus Siam [usw.]: Ebenda Nr
111—16. 9.—15. Mai: „Missionsberichte aus Siam. [Datiert:] Chambery,
April.“ Darin wird einiges aus Briefen des Missionsars Pallegoix
in Juthia (Siothia) vom Jahre 1833 mitgeteilt. Dieser berichtet
zunächst von dem Stande der siamesischen Missionstätigkeit
im allgemeinen und von seinen eigenen Schicksalen; von den harten
Entbehrungen und Heimsuchungen durch Krankheit, Tod, feindselige
Menschen und Tiere, und den sehr bescheidenen Erfolgen. Alles in
der schlichten und sympathischen Weise eines Mannes, dem sein
Glaube immer neue Seelenstärke verleiht, im Dienste seines Gottes
alles dies freudig zu ertragen. Im zweiten Teile spricht er vom religiösen
Leben der Eingeborenen des Landes und gibt von diesem
Schilderungen, die kulturgeschichtlich bemerkenswert sind. — S. 444,
am Ende dieses Teils, heißt es: „Es sind in dem großen Siam nur
noch zwei europäische Missionäre: Florent, apostolischer Vikar, siebzig
Jahre alt und schwach, und ich, denn Dechavannes [...] ist
vor einiger Zeit gestorben; [...]. Ich habe an ihm meine einzige
Hülfe und Stütze, meinen Freund und Bruder verloren, und bin
nun so zu sagen allein in dem weiten Land.“
In der Fortsetzung des Missionsberichts in Nr 114 vom 13. Mai,
S. 456, spricht Pallegoix vom Glauben der Siamesen an die Seelenwanderung.
Gegen Ende der Fortsetzung heißt es: „Aus der festen
Ueberzeugung, daß die Thiere unsere Brüder sind und daß des
Menschen Seele oft in sie gebannt ist, geht das Verbot, sie zu
tödten, hervor. Die frommen Siamesen kaufen oft lebende Fische
und werfen sie in den Fluß; sie geben Schweine und andere Thiere
in die Pagoden, damit sie dort auf ihre Kosten ernährt werden,
bis sie natürlichen Todes sterben.“
In der vorhergehenden Nummer, S. 452, spricht der Missionar von
der siamesischen Religionssekte der Talapoins. Er führt aus: „Talapoin
zu seyn, ist ein sehr verdienstliches Werk, es lange seyn, ist
noch verdienstlicher, es aber bis zum Tod seyn, ist eine große
Sünde; stirbt Einer in dem gelben Gewande (der Talapoinskleidung),
selbst wenn ihn der Tod so sehr übereilte, daß er es vor dem
Sterben nicht ablegen konnte, so ist er unfehlbar zur Hölle verdammt;
das Gewand fällt sogleich in die Hölle und wird da an
einer dicken Eisenstange aufgehängt, die täglich siebenmal zerbricht,
so groß ist die Menge der gelben Kleider, die da hängen.“
[Bd. b6, S. 602]
In den Nummern 115—16 schildert der Briefschreiber weiter das
aus seinem Seelenglauben sich ergebende Verhältnis des Siamesen
zu den Tieren. Er behandelt ausführlich den Kult des weißen
Elefanten; dabei ist sein Ton ruhig, sachlich, nur hie und da ein
wenig ironisch. Sein Interesse ist ein rein menschliches, kein theologisches.
Über die Ursachen dieser Verehrung führt er nur an,
was er von Anderen gehört hat. (S. 464.) Dort schreibt er noch:
„Fast gleiche Verehrung und gleiche Privilegien werden dem weißen
Affen zu Theil; [...] Die Siamesen haben überhaupt mehr Respekt
vor den weißen Thieren, als vor den farbigen. Wenn ein Talapoin
einem weißen Hasen begegnet, so grüßt er ihn, da er dies doch
keinem Fürsten thut ... Kein Siamese darf auch ein Ey zerbrechen,
abermals bei Strafe der Verdammung.“
S. 252, Z. 11: p. 446 wird die Politik [usw.]: „Ebenda Nr 111
bis 14. 9. — 13. Mai: „An die moderne deutsche Belletristik und ihre
Söhne. Von Friedrich Rohmer.“ Dieser Aufsatz, in dem der damals
einundzwanzigjährige studiosus juris zum ersten Male als Politiker
hervortrat, und in dem er sich gegen den politischen und sozialen
Radikalismus des Jungen Deutschlands wandte (vgl. Paul Rannacher,
Inhaltsangabe seiner Dissertation über „Friedrich Rohmer als
Politiker“ im „Jahrbuch der Philosophischen Fakultät zu Leipzig
für das Jahr 1920, I. u. II. Teil“, I. Halbjahrsbd. S. 17—19),
erschien bald darauf auch erweitert als Broschüre unter dem Titel:
„An die moderne Belletristik und ihre Söhne und die Herren Gutzkow
und Wienbarg insbesondere“ (Stuttgart, Hallberger 1836). Seine
erste Fortsetzung (S. 446) beginnt mit den folgenden Worten: „So
habt ihr auch die Politik verdorben, und diese große Gestalt, keusch,
mit egyptisch-langsamem Tiefsinn hinschreitend über Glück und Unglück,
über neues und altes Wissen, über Reformation und Restauration,
unmenschlich, darum unantastbar von Menschenhand, sie,
die unabhängig ist von eurer Aufklärung oder Verfinsterung —
zu eurer Metze wolltet ihr sie machen, und seyd in bester Zuversicht,
sie gehöre euch mit ganzer Seele [....].“
S. 252, Z. 12—18: p. 450 ist die Idee [usw.]: Ebenda Nr 111-16.
9.—15. Mai: „Natur- und gewerbwissenschaftliche Berichte. Von Dr.
[Joseph Emil] Nürnberger.“ In der, in Nr 113, S. 450—51, stehenden
Fortsetzung heißt es S. 451: „[...] ich [...] beschränke mich
daher auf die Bemerkung, welch weitere unermeßliche Schätze die
Tiefen der Erde noch enthalten mögen, welche gehoben werden
könnten, wenn es gelänge, weiter als bisher in die Tiefe hinab zu
dringen, und wie zweckmäßig es demnach erscheinen möchte, meinen
in der Versammlung der Naturforscher zu Wien gemachten Vorschlag
eines möglichst tiefen Schachtes zur Entdeckung solcher Schätze
zu befolgen. Ich sehe keinen Grund ein, warum man nicht wenigstens
tiefer in die Erde dringen könnte, als bisher, [...].“
S. 252, Z. 19—21: Literaturbl. Nach p. 190 oben hab' ich
[usw.]: „Literatur-Blatt“ Nr 48—50. 8.—15. Mai: Rezension der
folgenden Werke des Fürsten Hermann Pückler-Muskau: „1) Tutti
Frutti. Aus den Papieren des Verstorbenen. Dritter bis fünfter
Band. Stuttgart, Hallberger, 1834. 2) Andeutungen über Landschaftsgärtnerei,
verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung
in Muskau. [...] Mit 44 Ansichten und 4 Grundplänen. Stuttgart,
[Bd. b6, S. 603]
Hallberger, 1834.“ Beide Werke werden im ganzen lobend und
anerkennend besprochen. — S. 189—90 heißt se: „Der dritte Band
[des „Tutti Frutti“] beginnt mit Abfertigungen von Rezensenten.
Dann folgt eine zweite Zeichnung [falsch statt 'Ziehung'] aus den
Zetteltöpfen eines Unruhigen. Folgende Stellen mögen sie charakterisiren.
'Morgenspräch.
Der Herr: War er drinnen?
Der Diener: Wer?
Der Herr: Der Pinsel.
Die Frau: Welcher?
Allgemeines Gelächter.
Dieser Zettel ist von meiner Hand geschrieben, und wird daher
wohl etwas bedeuten. Dennoch muß ich gestehen, daß ich selbst
nicht mehr weiß, was; irre ich aber nicht, so muß eine einstige
Geliebte Goethe's den Sinn vollständig erklären können. — Rathe,
Leser, es wird dir Mühe machen. Errathe und du wirst große Zufriedenheit
darüber empfinden.'“ („Tutti Frutti“ S. 3.)
Ähnlich findet sich diese Stelle in Pücklers Brief an Bettinen
vom 20. März [1833?]; sie lautet dort folgendermaßen:
„Schön ist der Besuch in der Kirche, den laß ich drucken, wenn's
erlaubt ist. Er hat mich erbaut, und in der Phantasie ging ich
nach, da entspann sich nun um mich her folgendes prosaisch-aufweckendes
Gespräch:
Herr. War er drin?
Diener. Ja.
Frau. Wer?
Herr. Der Pinsel.
Frau. Welcher?
Allgemeines Gelächter.
Das Gespräch ist wirklich wahr, was es bedeute, weiß ich nicht.“
Vgl. den „Briefwechsel des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau
“, hrsg. von Ludmilla Assing, Bd 1 (= „Briefwechsel und Tagebücher
des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau“, hrsg. von Ludmilla
Assing, Bd 1). Hamburg, Hoffmann & Campe 1873. S. 114.
Jedoch ist dieser Brief nicht die Quelle zu der Stelle im „Tutti
Frutti“, dessen erste vier Bände, wie wenigstens der Fürst in seinem
Schreiben an Bettinen vom 27. Februar 1834 (a.a.O. S. 211) behauptet,
„vorher“, d. h. vor Beginn seines Briefwechsels mit ihr, geschrieben
worden seien.
Grabbes Bemerkung: „hab' ich Pückler im Bettinchen richtig errathen
“ bezieht sich auf eine Stelle seiner Rezension von „Goethe's
Briefwechsel mit einem Kinde“, in der er mit Bezug auf den Fürsten
geschrieben hatte:
„Der große Naturschilderer, welcher die wald- und stromdurchrauschten
Wesergegenden durchreis't hat und sie damit beschreibt,
daß er sie nicht gesehen, der Verstorbene mit der fleißig aufgehobenen
[Bd. b6, S. 604]
Maske hat dieses Gezeug gewidmet erhalten. Ob er nicht
Compagnon?
Die prächtigen tutti frutti, oder wie der alberne Titel heißt,
widersprechen der Vermutung nicht.“ (Bd 4,
Z. 5.)
Noch deutlicher heißt es in seinem Briefe an Immermann vom
8. Mai 1835: „Und ich glaube fast, der Reisebeschreiber, welcher
das Wesergebirg übersah, und bisweilen gute, dann trübe Stutzeraugen
hat, Pückler-Muskau, hat geholfen. Das Buch ist ihm ja gewidmet
und riecht nach seiner Manier. Er liebt Honorare, vielleicht
auch geteilte?“ (Vgl.
Fürst Pückler-Muskau ist in der Tat an der Entstehung von
Bettinens Werke nicht ganz unbeteiligt gewesen, wie sich aus dem
schon herangezogenen Briefwechsel der Beiden ergibt. Jedoch ist
seine Mitwirkung von etwas subtilerer Art, als Grabbe vermutet,
und keineswegs durch so grob-materielle Motive bestimmt.
Bettine hatte begonnen, dem Freunde in ihren Briefen mancherlei
über Goethe, Gedanken und Erinnerungen, mitzuteilen. Der
Fürst fand Gefallen daran; unterm 20. März 1832 ermahnt er sie:
„Du bist eine ächte Dichterin — und schöner kann sich des Weibes
Gemüth nicht aufthun, als in Deinen letzten Briefen. Fahre ja mit
Goethe aus Deinem Leben fort, und verschweige nichts, thue Dir
auch nicht den leisesten Zwang an, schreibe als sprächest Du zu
Dir selbst, je schleierloser Du dastehst, je mehr kannst Du nur bei
mir gewinnen.“ (A.a.O. S. 95.)
Dann kam ihr die Idee, zu Gunsten des Goethe-Monuments ein
Buch zu veröffentlichen; und zwar dachte sie anfangs daran, den
Fürsten als Herausgeber zu gewinnen. Unterm 11. April 1 schreibt
sie deswegen an die Fürstin: „[...] ich hätte dem Fürsten so gern
meine Briefe an Goethe anvertraut, und noch ein Tagebuch an
Goethe, worin viele merkwürdige Geschichten meiner Jugend enthalten;
rührend und schön wie kein anderer, ist dieser Ausbruch
von Liebe; ja, ich weiß gewiß, daß es sich mit dem Wunderbarsten
und Ergreifendsten vergleichen läßt; ich hatte es aufgespart und
niemand gezeigt, weil ich es Ihm vorschlagen wollte, es herauszugeben
zum Besten von Goethe's Monument; doch ist mir's jetzt,
als werde nichts daraus werden, und als müsse ich mich an Andere
wenden; es schmerzt mich, wie eine gezwungene Untreue schmerzen
würde. Ich bitte daher Ew. Durchlaucht ihm es vorzuschlagen, und
zu fragen, ob er dazu geneigt sei, und ob er mir so viel Gehör
schenken werde, daß ich ihm das Ganze auseinandersetze, und wenn
er's verwirft, dann erst suche ich meinen anderen Weg.“ (A.a.O.
S. 98.)
[Bd. b6, S. 605]
Der Fürst schien geneigt zu sein, auf diesen Vorschlag einzugehen.
Wenigstens schrieb er unterm 3. Juni 1833: „Schicke mir also
Deine Briefe, die ich zu Gunsten des so herrlich von Dir erfundenen
Monuments herausgeben soll, und schreibe mir ausführlich
Deinen Willen darüber.“ (A.a.O. S. 114.) Jedoch änderte nachher
Bettine, aus Gründen, über die der Briefwechsel nichts ergibt, ihre
Absicht, nahm einen Dritten als den Herausgeber ihres Werkes in
Aussicht, und bat nun den Fürsten, ihr diejenigen Briefe, in denen
etwas von Goethe stehe, auf kurze Zeit einzuhändigen. (A.a.O.
S. 115—16.) Zur Erfüllung dieser Bitte gelangte sie erst nach langem
Kampfe, worauf hier nicht eingegangen zu werden braucht.
Am Ende aber übernahm sie die Arbeit ganz allein. Mitte Septembers
erschien sie plötzlich in Muskau, nicht, wie sie schreibt, um
den Freund zu sehen, sondern um den Park, den er sein Herz
nenne, im Stillen zu genießen, und sich durch diesen schönen Reiz
in ihrer Arbeit begeisternd zu steigern. (A.a.O. S. 130—31.) Der
Besuch führte zu einer ernstlichen Trübung ihrer Freundschaft. Denn
Bettine hatte sich, wie die Herausgeberin des Briefwechsels zu
dieser Episode (A.a.O. S. 136) kommentierend bemerkt, so benommen,
als wenn sie ein entschiedenes Liebesverhältnis mit dem Fürsten
habe, es dabei auch an der erforderlichen Rücksicht gegen
die Fürstin fehlen lassen, so daß der Fürst ihr schließlich seinen
Wunsch, sie möge abreisen, nahegelegt hatte. Bettine schied gekränkt,
und der Briefwechsel nahm einen anderen Charakter an.
Sie machte sich nun wieder an das Ordnen ihres Briefwechsels mit
Goethe, eine „schwere Arbeit“, „die mitten im Tumult aufgeregter
Gefühle gesammeltes Denken und Gegenwart des Geistes fordert“
(A.a.O. S. 142.) Es hemmte sie aber die Verstimmung zwischen ihr
und dem Freunde, und so bekennt sie ihm: „Es hat jedoch auf
meinen Geist einen sehr niederschlagenden Einfluß gehabt, mein
Denken nicht mehr an Sie richten zu können. Mit Goethe's Korrespondenz
hab' ich aussetzen müssen, diese Kinderbriefe voll inniger
Zuversicht, und meine Briefe an Sie machen mich gleich traurig,
und sind mir gleich wichtig.“ (Im Briefe vom 21. November 1833,
A.a.O. S. 146.) Der Fürst überhörte nicht den Ton der Sehnsucht
in diesen Zeilen. Deshalb fuhr er, nachdem er ihr in seiner Antwort
vom 25. November seine Forderungen an eine künftige
Korrespondenz auseinandergesetzt, folgendermaßen fort: „Ist Dir
aber jene alte Art unserer Korrespondenz, wie Du sagst, nöthig,
um Dein Werk über und an Goethe zu vollenden, so schreibe wie
Du willst, denn es wäre sehr grausam von mir, wenn ich Dich und
die Welt um etwas so Schönes, Originelles, ja vielleicht Einziges
in seiner Art bringen wollte, als dieses Werk ohnfehlbar werden
muß, wenn Du Dich nicht zu sehr darin gehen läßt, und bedenkst,
daß kein Kunstwerk durch bloße Phantasie ohne Zwang und Mühe
und sehr verständige Sichtung zu Stande kommen kann.“ (A.a.O.
S. 151.) Jetzt aber meinte Bettine, von dem Gefühle befreit zu
sein, den Fürsten für ihre Arbeit nicht entbehren zu können. Deshalb
erwiderte sie ihm auf jene entgegenkommende Wendung: „Sie
bieten mir an, meine Korrespondenz mit Ihrem Doppelgänger,
Ihrem hölzernen Repräsentanten, dem gemalten Hirsch 1, fortzuführen,
wenn es nöthig sein sollte, um mein Werk über Goethe zu
[Bd. b6, S. 606]
vollenden. Nein, es ist nicht nöthig, ich hab' meine Niedergeschlagenheit
überwunden, und jetzt, wo ich beinah überzeugt bin, daß
es nur der gemalte Hirsch war, von dem ich in Muskau alle Kränkung
erlitt, fühl' ich mich wie umgewandelt, und wirklich in
magnetischer Beziehung mit Goethe.“ (Brief vom 15. Dezember
1833. A.a.O. S. 155.)
Die freundschaftliche Korrespondenz ging also weiter, und Fürst
Pückler schrieb an Bettinen: „Leb' wohl, und dichte fort, so schön,
als Du es hier uns zu enthüllen angefangen 2, denn Dein Werk wird
Du sein, wie in vielem und tiefen Sinne Du Dein Werk bist.
Adieu.“ (Brief vom 25. Dezember 1833. A.a.O. S. 159.) Als sie
ihm ein Vierteljahr darnach bekennt, daß sie es nur wenig habe
fördern könnnen (Brief vom 23. März 1834. A.a.O. S. 242), da
drängt er die Freundin: „Sei aber ja eilig und fleißig mit Deinem
Werk! Es taugt nichts, wenn es so lange erwartet wird, wie ich
bei meiner Schartecke hinlänglich gewahr geworden bin —“. (Brief
vom 27. März 1834. A.a.O. S. 244.) Dem entgegnet sie: „Sie rathen
mir freundlich an, meine Herausgabe zu beschleunigen, das liegt
nicht in meinen Kräften, ich bin fleißig so viel ich kann, ich war
jedoch bisher sehr untüchtig, und habe durch Schlaf allmählig meine
verschiedenen Aufregungen wieder beschwichtigen müssen; dazu
kommt noch, daß jeder Brief, den ich von mir und Goethe in
Reih' und Glied bringe, mich auf's neue aufregt, und daß alles,
was noch außerdem mich berührt, schmerzlich damit einklingt.“
(Brief vom 2. April 1834. A.a.O. S. 250.)
Am 25. Juli 1834 ist ihr Buch „am Schluß“. (A.a.O. S. 259.)
S. 252, Z. 22—24: pag. 180 wird die weltbekannte Eroberungsgeschichte
[usw.]: Ebenda Nr. 45. 1. Mai. S. 179—80: Rezension
der „Extraits des historiens arabes, relatifs aux guerres des croisades
etc., par M. [Joseph-Toussaint] Reinaud. A Paris, imprimerie
royale. [Ducollet, 1829.].“ S. 180 wird daraus ein muselmännischer
Bericht über die Eroberung Antiochias durch Bohemund (1098 n.
Chr.) mitgeteilt, das durch den Verrat eines rachsüchtigen Harnischfabrikanten
in die Hände der Christen fiel. Er soll lediglich
als Beispiel dafür dienen, mit welcher Offenheit die Orientalen auch
ihre Niederlagen beschreiben; davon, daß er als neu ausgegeben
werden solle, kann keine Rede sein. — Übrigens sind noch Wilken
(„Geschichte der Kreuzzüge“ Bd. 1. Leipzig, Crusius 1807. S. 198
bis 202) mehrere der hier mitgeteilten Einzelheiten unbekannt. Er
bezeichnet den Verräter als einen christlichen Renegaten namens
Pyrrhus, bemerkt, daß die Nachrichten über diesen sehr verschieden
lauteten, und kann noch nichts über seine Motive aussagen. Ähnlich
verhält es sich mit Johann Christian Ludwig Haken („Gemälde
[Bd. b6, S. 607]
der Kreuzzüge nach Palästina zur Befreiung des heiligen Grabes.“
T. 1. Frankfurt a. d. Oder, Akademische Buchhandlung 1808. S.
284—99). Er nennt als den Verräter einen Armenier, den christlichen
Renegaten Firuz (Pyrrhus). Sein ausführlicher Bericht ist im Ganzen
demjenigen Wilkens verwandt. — Galettis Compendium: Der auch
in den „Betrachtungen“, einem Beitrage Grabbes zum „Düsseldorfer
Fremdenblatte“ (siehe Bd 4,
Georg August Galletti (1750—1828), Herzogl. Sächs. Hofrat, Historiograph
und Professor, Verfasser zahlreicher geschichtlicher und
geographischer Werke, Lehr- und Elementarbücher.
S. 252, Z. 25 f.: Alles über den Pückler [usw.]: Daß Fürst Pückler
selbst keine übertriebene Meinung von seinen „Tutti Frutti“
hatte, lehrt seine Selbstkritik im Briefe an Bettinen vom 9. Januar
1834: „Ich werde Dir bald die 'Tutti Frutti' senden. Es ist eigentlich
ein jämmerliches Buch! Nimm es wie es ist, und vor allem
nicht als den Ausdruck meiner wahren Gesinnungen. Es ist ein
thörichtes Geschwätz, aber doch nicht verfehlt, wenn es anmuthig
ist. Ich habe aber auch dazu nur schwaches Zutrauen, und der
Eitelkeitsfehler, es pikant machen zu wollen, ist im Grunde, ich
fühle es wohl, ein Makel, wenn er auch momentan den Zweck erreichen
sollte zu interessiren.
Ich werde schon einmal besser schreiben, oder ganz aufhören.
Dir kann das Buch an sich nicht gefallen, aber doch in so fern
Dich anziehen, als Du meine Inkonsequenz darin studirst, und Dir
beim Anblicke solcher schwachen Chamäleonnatur sagen kannst, daß
ich die besseren Farben hier für Dich niederlege, und dem Publikum
nur die unächten auftische.“ (A.a.O. S. 178.)
S. 252, Z. 27—30: Kunstbl. Gräßlich dießmal. Ich meine
[usw.]: „Kunst-Blatt“ Nr 36—37. 5. u. 7. Mai: „Memnon. Von
F.[riedrich] A.[ugust] Ukert“, dem Erzieher der Söhne Schillers.
damals Lehrer am Gymnasium und Bibliothekar an der herzoglichen
Bibliothek in Gotha. Bekannt ist er vor allem durch seine
selbständigen Forschungen auf dem Gebiete der Geographie geworden.
Der in Frage stehende Aufsatz behandelt ausführlich die
Memnon-Sage und -Statue. Sein Beschluß beginnt mit dem Satze:
„Unter Augustus hören wir zuerst von der tönenden Statue.“
(S. 149.) — Daß bereits Herodot (um 484 bis um 425 v. Chr.)
das Memnontönen erwähne, ist in der Tat eine irrige Vermutung.
Der erste, bei dem ein Bericht darüber sich findet, ist vielmehr
Strabo (um 60 v. Chr. bis 20 nach Chr.), im siebzehnten Buche
seiner „Geographica“. Vgl. dazu den Aufsatz: „Von der tönenden
Memnonssäule“ in Nr 295—96 des „Morgenblattes“ vom 10. u.
11. Dezember 1833, wo es S. 1177—78 heißt: „Herodot und Diodor
sagen kein Wort von der tönenden Bildsäule, und nicht nach
ihnen, sondern nach weit unzuverlässigern Schriftstellern hat einer
dem andern nachgesagt, die Statue sey von Cambyses zerbrochen
worden. Der erste Text, in welchem das Phänomen des Tönens
erwähnt wird, ist der des Strabo: bei der Beschreibung der beiden
Monolithen in der Ebene von Theben erzählt er, der eine derselben,
den er aber, wohlgemerkt, nicht Memnon nennt, habe durch ein
Erdbeben seinen obern Theil eingebüßt, und erwähnt mit sichtbarem
[Bd. b6, S. 608]
Mißtrauen des Tons, den die Statue einmal des Tags hören lassen
solle.“
S. 252, Z. 31—33: Intellbl. p. 55. „Meine Erfahrungen
[usw.]: „Intelligenz-Blatt“ Nr 14. 2. Mai. S. 55: Die Cottasche
Buchhandlung zeigt dort u. a. das Erscheinen der folgenden Bücher
an: „Meine Erfahrungen in der höhern Schafzucht“ von I. G. Elsner,
„Handbuch der veredelten Schafzucht“ von demselben, „Beiträge
zur höhern Schafzucht“ von N. W. Pabst, „Anleitung zur
Rindviehzucht und zur verschiedenartigen Benutzung des Hornviehs“
von demselben, „Unterricht über die Pferde-Huf-Beschlage-Kunst
und die Behandlung der kranken und fehlerhaften Hufe, nebst einer
Abhandlung über die Castration der Pferde“ von S. v. Hördt.
S. 252, Z. 34 f.: nr. 15 Wilckes Templergeschichte [usw.]: Ebenda
Nr 15 vom 13. Mai, S. 57, kündigt August Lehnhold in Leipzig
als neuerschienen an: „Wilcke, Dr. W.[ilhelm] F.[erdinand], Geschichte
des Tempelherren-Ordens nach den bekannten und mehreren
bisher unbekannten Quellen. 3ter Band. Auch unter dem Titel: Die
Templerei oder das innere Wesen des alten und neuen Ordens der
Tempelherren. gr. 8. 1835.“ — Über eine Geisteskrankheit Wilckes
hat nichts in Erfahrung gebracht werden können. Vielleicht aber
liegt überhaupt eine Verwechslung mit Friedrich Wilken, dem Geschichtschreiber
der Kreuzzüge, vor, der im Frühjahr 1823 in eine
schwere geistige Erkrankung verfallen und von dieser erst im Juni
1827 völlig geheilt war. (Vgl. ADB Bd 43, S. 239—40.)
S. 252, Z. 36—38: Maltens Weltkunde. Ach das Elsaß
[usw.]: „Maltens Weltkunde“ Bd. 2, 4. Teil. S. 3—34: „Die alten
und die neuen Republikaner in Frankreich. Geschichtliche Erörterung.
Erster Abschnitt.“ Der Aufsatz setzt sich zum Ziele, die
Wirkung der französischen Revolution auf das Elsaß zu untersuchen,
zu erweisen, daß es sich dabei um eine Gegend handle, „die
von Grund aus deutsch ist, die bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts
ein integranter Theil Deutschlands gewesen, und die, obgleich
sie bereits 150 Jahre unter französischer Botmäßigkeit gestanden,
ihre deutsche Eigenthümlichkeit dennoch nicht verloren“
habe. (S. 4.) Am Schlusse des Vorworts heißt es dann, zusammenfassend:
„Elsaß ist also blos dem Namen nach eine französische
Provinz. Gewohnheiten, Sprache, Sitten, Gebräuche, die Namen seiner
Oertlichkeiten und Einwohner selbst, sind durchaus deutsch.
Wir wollen damit jedoch nicht sagen, daß dies Land früher oder
später nothwendigerweise zu Deutschland zurückkehren müsse. Das
ist seine Sache, nicht die unsrige.“ (S. 7.)
S. 252, Z. 39 f.: Russen und Engländer lassen in Asien [usw.]:
Ebenda S. 34—58: „Reise auf dem Indus und durch Inner-Asien.“
Der Aufsatz beginnt mit der Feststellung, daß die britische Regierung
Ostindiens seit Langem einen begehrlichen Blick auf die herrlichen,
vom Indus bewässerten Gegenden geworfen habe, die der
Maha-Radscha Rundschit Sing beherrsche. Ihren politischen Grundregeln
getreu, habe die ostindische Gesellschaft mit dem Monarchen,
den sie seiner Staaten berauben wolle, zuerst freundnachbarliche
Beziehungen angeknüpft, seitdem aber keine Gelegenheit vernachlässigt,
genau alle Zugänge und Verbindungswege des Landes zu
[Bd. b6, S. 609]
erkunden, das sie wahrscheinlich binnen kurzem sich unterwerfen
werde. Ganz besonders habe sie sich dabei um die nähere Erforschung
des Indus, als des leichtesten und kürzesten dieser Wege
bemüht, alle ihre Unternehmungen seien jedoch bisher an der Wachsamkeit
des Maha-Radscha gescheitert. Daher habe im Jahre 1830
der Statthalter von Bombay, unter dem gedachten Vorwande, eine
neue Expedition zur Erforschung des Indus nach Lahur, der Hauptstadt
Rundschit Sings, abgesandt. Dem Tagebuche des Hauptmanns
Burnes, Leiters dieser Expedition, sind die nun folgenden Mitteilungen
entnommen.
S. 253, Z. 1 f.: p. 59 ect. Das dummste Zeug [usw.]: Ebenda S.
59—88: „Karakteristisches Gemälde des weiblichen Geschlechts bei
den verschiedenen Völkern des neuern Europa's.“ Der Aufsatz schildert
die Verschiedenheiten in den Sitten und Gewohnheiten der
Frauen Westeuropas (gelegentlich auch der nordamerikanischen Freistaaten)
in der neueren Zeit, dabei besonders die Seite der Erziehung
berücksichtigend. — Mit Freimut, doch stets mit Geschmack,
ist dabei (S. 62) die Rede von „zu vertraulichen oder schlüpfrigen
Tänzen“ und „dem Lesen gewisser Romane, deren zweideutige Darstellungen
verzehrende Funken in das Gemüth werfen“, (auf S. 74
werden „schlüpfrige Romane“ erwähnt,) oder von der Sittenfreiheit
mancher Kreise Italiens, wo die Frau einen Gatten, einen Zizisbeo,
einen Liebhaber, einen Cavaliere servente, einen Hausfreund, einen
Inamorato und endlich einen Aspiratore habe (S. 72) und man sich
öffentlich und ohne alle Zurückhaltung über die Wirren und Wandlungen
der täglich sich ereignenden Liebesabenteuer unterhalte (S. 82).
Alles das aber wird man nicht gut „Zoten“ nennen können, und auch
sonst ist nichts in dem Aufsatz zu bemerken, was diese Bezeichnung
verdiente. — Vom Schruppen (siehe dazu Bd 1,
die Anmerkung dazu
(S. 69—70) von seinem Seitenstück, der „großen Wäsche“.
S.253, Z. 3—6: Nordamerika wird Monarchie [usw.]: Ebenda
S. 89—109: „Interessestreit zwischen Frankreich und der nordamerikanischen
Union, nebst einer Erörterung des innern politischen Zustandes
dieser letzten. Zweiter Artikel.“ Es handelt sich um den
Interessestreit, der mit dem Konflikt zusammenhängt, den Präsident
Jackson im Jahre 1832 durch sein Veto gegen das Vereinigte
Staaten-Bankprivilegium mit dem Senate hervorgerufen hatte. —
Der Verfasser ist der Ansicht, daß der letzte Grund dieses Konfliktes
der geheime Kampf der im Schoße der Nation bestehenden
Mächte sei, nämlich der Einfluß des Reichtums und die demokratische
Gleichheit. In dem Artikel wird nur diese innerpolitische Seite
des Konflikts erörtert.
Der Verfasser stellt die Frage, ob die Bundesverfassung der Union
genügen werde, der Gefahren Herr zu werden, die sie bedrohen.
Diese Gefahren erwartet er als eine natürliche Folge der Prinzipien
von 1793. Er ist der Meinung, daß jetzt, wo die amerikanische
Mehrheit aus Eigentümern bestehe, noch keine Staatsumwälzung zu
besorgen sei, sondern nur vorübergehende Unruhen. Aber die rasch
fortschreitende Vermehrung der eigentumslosen Masse und die Verbreitung
der Grundsätze, der Ungleichheit des Standes wie des Vermögens
[Bd. b6, S. 610]
den Krieg zu erklären, sei ohne Zweifel ein über dem
Haupte des nordamerikanischen Volkes schwebendes Damoklesschwert.
Der Aufsatz beginnt mit einem Zitat aus einem „der neuesten Bericht
-Abstatter über die Union“, in dem es heißt: „Es ist sehr
wahr, daß die Demokratie zu Neu-York tiefe Wurzeln geschlagen
hat. Es ist sehr wahr, daß die Demokraten bereits im geheimen
Kriege sind mit denen, die schöne Häuser bewohnen, die
Malaga-Wein trinken, die Romane und Zeitschriften lesen. Dieser
geheime Krieg gewinnt immer mehr innere Erbitterung.
An jedem Jahrestage der Räumung Neu-Yorks durch die englische
Armee (den 25. November), macht die Anmaßung der Demokratie
neue Fortschritte und bekundet sich auf eine immer fühlbarere
Weise.“ (S. 89—90.)
In der Tat muß auch der Verfasser konstatieren, daß seit Washingtons
Tode die nördlichen Staaten immer entschiedener der reinen
Demokratie sich zugewandt hätten. Die Menge entscheide hier in
allen Angelegenheiten, und da die Bevölkerung sich alle 24 Jahre
verdopple, so werde sie bald zermalmend werden. Wenn erst das
ganze fruchtbare Land mit Einwohnern bedeckt sei und man keine
Stelle mehr finde, die der erste beste ausbeuten könne, dann werde
der Arbeitslohn sich notwendigerweise vermindern, Not und Elend
fühlbar werden. Wenn aber die von der großen Masse ernannten
Gesetzgeber sich bemühen würden, die Bedürfnisse der leidenden
Mehrheit zu befriedigen, dann werde das Eigentum in Amerika, in
Form einer „gesetzlichen Beraubung“, einen tödtlichen Streich erhalten,
und man könne nicht annehmen, daß die Republik, gegründet
auf dem alleinigen Grundsatze der Mehrheit, durch diese Verfassung
genügend geschützt sei, wie ihre enthusiastischen Verteidiger unbeirrbar
glauben machen wollten, über deren glücklichen Optimismus
und politische Kurzsichtigkeit der Verfasser sich in Spott ergeht.
Eine Skizze der Entwicklung des demokratischen Geistes bis hin
zu ihrer Einmündung in den bezeichneten Konflikt schließt sich an
diese Darlegungen an.
S. 253, Z. 7—9: p. 124. Das Unthier! Japans Landwirthschaft
[usw.]: Ebenda S. 122—40: „Neueste Nachrichten über Japan; den
Ursprung, die Geschichte und Zivilisation, wie den innern Zustand
dieses Landes betreffend. Letzter Aufsatz.“ Darin heißt es S. 124
unten: „Ihre [der Japaner] Landwirthschaft hat bereits ziemliche
Fortschritte gemacht. Dagegen ist die Gärtnerei noch in der Wiege,
obgleich sie große Blumen-Liebhaber sind, und man ihnen die
Camelia verdankt. Sie setzen ein Verdienst darin die größten
Pflanzen auf die möglichst kleinsten Verhältnisse zu reduziren.“
S. 253, Z. 10 f.: Der neue Leonidas [usw.]: Ebenda S. 141—68:
„Merkwürdige Rechtshändel in Frankreich.“ Darin S. 146—48: „Ein
neuer Leonidas.“ Es ist der Abdruck eines Berichtes aus der Pariser
Tribunal-Zeitung über einen Prozeß gegen den Handelsagenten
Frantz, in dem es (S. 146—47) heißt: „Hr. Frantz war 1815 Advokat
in Metz. Als er erfuhr, daß die fremden Horden zum zweiten
Male mit ihrer Gegenwart den geheiligten Boden des Vaterlandes
zu besudeln beabsichtigten, verkaufte er seine Besitzungen, die beträchtlich
[Bd. b6, S. 611]
waren, verlies den Advokatenstand, und stellte sich an die
Spitze eines Freikorps, bestehend aus 500 Infanteristen und 120
Reutern, die er auf seine Kosten gekleidet und bewaffnet hatte.
Mit dieser Handvoll Patrioten schlug er 12_000 Preussen5* ([Dazu
die Anmerkung:]5* Ein preussisches Armeekorps von 12_000 Mann
mußte wenigstens 30 Kanonen haben. Frantz hatte nicht eine. Demungeachtet
schlug er jenes Korps (wahrscheinlich im Traume) und
nahm ihm alles Geschütz. Die Franzosen glauben eine solche
Aufschneiderei, wie abgeschmackt sie auch sei.) in die Flucht, nahm
ihnen fast alles Gepäck und alle ihre Kanonen.5*5* ([Dazu die Anmerkung:]
5*5*) Wahrscheinlich ein Druckfehler. Man lese hundertzwanzigtausend
Preussen.)“
S. 253, Z. 12 f.: Der Aufs. über die Bibliotheken in Spanien
[usw.]: Ebenda S. 197—203: „Die öffentlichen Bibliotheken in
Spanien, und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und literarischen
Schätze.“ Dem knappen Hinweis auf die wichtigsten spanischen
Bücher- und Handschriften-Sammlungen geht eine ebenso knappe
Übersicht über die geschichtliche Entwickelung des spanischen
Bibliothekswesens voraus.
S. 253, Z. 14: In dem Buch sitzt Zschockke, das Würmlein: Der
Name Heinrich Zschokkes (1771—1848) wird in dem ganzen vierten
Teile von „Maltens Weltkunde“ nicht genannt. Wenn also
Grabbe nicht den strengmoralischen Standpunkt meint, der manche
der Aufsätze unverkennbar beherrscht, so kann seine Bemerkung
nur auf die, auf S. 221—24 stehende Rezension von Bd 1, Heft 1
(1835) des „Schweizerischen Merkurs“ gedeutet werden,
einer Monatszeitschrift, herausgegeben von mehreren schweizerischen
Schriftstellern, welche folgendermaßen beginnt: „Ein Bote
des Friedens und seiner unschätzbaren Segnungen: 'des öffentlichen
Wohlergehens, der materiellen und intellektuellen Gedeihlichkeit,
des vernunftgemäßen, heilbringenden Fortschrittes und der milden
Gaben freundlicher Muse,' tritt der schweizerische Merkur auf
in einer vielbewegten Zeit.
Seine Bestimmung ist glücklich: ein ruhig blühendes Tempe zu
gründen, wo in Wahrheit und Licht, unter Gesetz und des Schönen
väterlicher Obhut, die edleren Gemüther in der Schweiz sich
vereinen, durch einfachen Austausch ihrer Gefühle, ihrer Gesinnungen
sich gegenseitig verstehen und erheben können, um nicht allein
den Angehörigen ihres eigenen herrlichen Vaterlandes, sondern auch
den durch Sprache, Karakter und Sitten, wie durch gemeinsame Abstammung,
mit der deutschen Schweiz nahe verwandten Bewohnern
Deutschlands einen überzeugenden Beweis zu geben, 'daß nicht jede
wohlthätig schaffende literarische Erzeugungskraft in den Adern
Helvetiens erschöpft ist, daß es doch nicht zur poetischen, oder vielmehr
zur unpoetischen Steppe von dem tödlichen Harmattan
unfruchtbarer politischer Polemik ausgedorrt ist.'“
Auf der dritten Seite des Umschlages steht ferner eine Anzeige
des Verlegers des „Schweizerischen Merkurs“, C. Langlois, Burgdorf
in der Schweiz.
S. 253, Z. 15—21: Miscellen. p. 166. Daß der verlaufene
d' Haussez [usw.]: „Miscellen“ Bd 83, Heft 5. S. 165—238: „Bruch-
[Bd. b6, S. 612]
stücke aus dem Reisetagebuche des Ex-Ministers de Haussez. (Beschluß.)
“ Der achte Paragraph handelt über die „Politische Lange
des Oesterreichischen Italiens“. Er hat die Verteidigung der österreichischen
Herrschaft zum Ziele. Man hat, so beginnt der Verfasser,
die österreichische Regierung in Italien beschuldigt, daß sie
tyrannisch sei und die ihrer Dynastie unterworfenen Völker nicht
mit Milde und Gerechtigkeit regiere, und die Dynastie selbst, daß
sie die Fürsorge, sich in der Herrschaft zu behaupten, übertreibe.
Darauf erwidert er (S. 166) folgendes: „Da ich einige Beweggründe
habe, um zu glauben, daß die Fürsten nicht immer Unrecht haben,
da ich es ferner für eine Schuldigkeit halte, solche nicht eher zu
tadeln, bis ich mich von ihren angeblichen Uebelthaten völlig überzeugt,
so habe ich zu untersuchen versucht, ob die Anschuldigungen
der Oesterreichischen Regierung wirklich gegründet sind, und befunden,
was viele Leser in Erstaunen setzen, ja ihnen sogar anstößig
scheinen wird, daß diese Regierung nicht immer Unrecht
hatte, ja ich habe sogar anerkennen müssen, daß man sie gewissermaßen
gezwungen hat, zu den ergriffenen strengen Maßregeln
ihre Zuflucht zu nehmen.“
Um dies zu beweisen, schildert er die Wohltaten, die der Österreich
zugefallene Teil Italiens der neuen Regierung verdanke: „eine
gleiche Rechtspflege, eine wahrhaft wohlthätige Verwaltung“ (S.
166—67), wichtige Verbesserungen auf dem Gebiete der Munizipalverwaltung,
des Unterrichts und des Gesundheitswesens, Förderung
des Handels und der Landwirtschaft. Dann heißt es weiter: „In
mehreren Fällen ertheilte die Regierung den Eingebornen die wichtigsten
Aemter in der Verwaltung. Einige mißbrauchten das ihnen
bewiesene Zutrauen, Andere handelten edler, daß sie solche ausschlugen,
zeigten aber darin ihren üblen Willen wider die Regierung.
Kann man es der Letzteren als ein Unrecht anrechnen, daß sie keine
Personen anstellt, welche ihr nicht dienen wollen?“ (S. 168—69.)
S. 253, Z. 22 f.: Die Lebensversicherung zu Gotha [usw.]: Nachdem
Grabbes Gesuch um Aufnahme in die Detmolder Witwenkasse
abgelehnt worden war, bewarb er sich unterm 1. Dezember
1833 bei der Gothaer Lebensversicherungsbank. Dort scheiterte sein
Vorhaben am Gutachten des Institutsarztes. Näheres siehe Bergmann,
„War Grabbe syphilitisch?“ („Zeitschrift für Sexualwissenschaft und
Sexualpolitik“, Bd 18, 1932, H. 8, S. 507—21), S. 518—21; „Grabbe
in Berichten seiner Zeitgenossen“ S. 94—100, unter Nr 71.
S. 253, Z. 24 f.: Ausland. 122. Rjäsan ist keine neue [usw.]:
„Ausland“ Nr 122. 2. Mai. S. 485—86: „Schreiben aus Rußland,
v. 20sten Febr. 1835.“ Es beginnt: „Abends bei ziemlich kalter Witterung
kam ich in Rjäsan an. Diese Stadt ist 130 deutsche Meilen von
St. Petersburg, und 26 Meilen von Moskau entfernt, und eine von
den neuen Städten, welche unter der Kaiserin Katharina II angelegt
und im Jahre 1783 zu einer Gouvernementsstadt erhoben
wurde.“ — Diese Angaben sind in der Tat insofern nicht richtig,
als Rjäsan (Rjasanj), die am rechten Ufer des Trubesch liegende
Hauptstadt des gleichnamigen russischen Gouvernements, nicht erst
unter Katharina II. (1729—1796), sondern bereits im elften Jahrhundert
gegründet worden ist. Grabbe irrt sich aber auch. Denn
[Bd. b6, S. 613]
er verwechselt Rjäsan mit dem, 50 Werst davon entfernt an der
Oka liegenden Altrjasan. Dieses ist, heute nur noch ein großes Dorf,
lange Zeit, bis 1517, die Residenz der Fürsten von Rjasan gewesen.
Vgl. Vivien de Saint-Martin, „Noveau Dictionnaire de
Géographie Universelle.“ Bd 5. Paris, Hachette 1892, S. 124.
S. 253, Z. 26—30: Lamartine kann zum Teufel gehen [usw.]:
Ebenda Nr 123—30. 3.—10. Mai: „Reise in den Orient von Lamartine.
“ Vierter bis siebenter Artikel. (Damaskus. — Die Maroniten. —
Konstantinopel. Türkische Gardeoffiziere. Der Sultan. — Das Serail.)
— Die „Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un
voyage en Orient (1832—1833)“ von Alphonse de Lamartine (4
Bde. Paris 1835) werden sich in der Tat nicht mit dem „Itinéraire
de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la
Grèce, et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne“ (3 Bde.
Paris 1811) messen können, einem der Hauptwerke Châteaubriands,
an das Grabbe fraglos denkt. — mit dem lieben Gott [usw.]: Anspielung
auf Lamartines Dichtungen „Méditations poétiques“ (1820),
„Nouvelles Méditations poétiques“ (1823) und „Harmonies poétiques
et religieuses“ (1830), die einen stark religiösen Charakter
tragen.
S. 253, Z. 29 f.: Wie's mit Peter und Michel ist [usw.]: Die beiden
Vornamen bedeuten hier wohl die Mächte Rußland und Deutschland.
S. 253, Z. 31—33: Rehberg thut's Maul auf zur Weltverbesserung
[usw.]: „Minerva Bd 174. (Mai.) S. 329—52: „Die neue Weltliteratur.
Vom Geheimen Cabinetsrathe Rehberg.1 ([Dazu die Anmerkung:]
1) Die Politik ist sowohl in der Speculation, als in der
wirklichen Welt, auf einen Punct gekommen, da es rathsam scheinen
kann, sich auf eine Zeitlang in die höheren Regionen der intellectuellen
Welt zurückzuziehen, und sich mit Betrachtungen über die
Entwickelung des menschlichen Geistes in anderen Richtungen zu beschäftigen.
Der Verfasser dieses Aufsatzes benutzt die otia, quae
Deus dedit, einen Beitrag zu der Beurtheilung des wissenschaftlichen
Strebens unserer Zeit zu geben.)“
In einem einleitenden Teile führt Rehberg folgendes aus: Seitdem
die europäischen Völker durch die großen Weltbegebenheiten
plötzlich einander näher gerückt seien, und die mannigfaltigen Be
rührungen auf die höheren geistigen Beziehungen gewirkt hätten,
habe der immer höher strebende Sinn sich eine Idee von Weltliteratur
gemacht, „in welcher alle cultivirte Nationen durch gemeinsames
Streben einen höheren Grad von Vollkommenheit in Wissenschaft
und Kunst erreichen sollten“ (S. 130). Einem solchen Streben
müsse alles Partikuläre aufgeopfert werden, dabei aber gehe notwendigerweise
vieles von dem verloren, „was den eigensten und
liebsten Besitz der einzelnen menschlichen Geschlechter ausmacht“
(S. 330—31). Nun sei das Eigentümliche des deutschen Geistes das
Talent der Abstraktion. Diese führe in der Wissenschaft zu der
Lehre von den höchsten Prinzipien; daher sei die Metaphysik unser
eigenstes Besitztum. Diese herrsche nicht allein bis in die untergeordneten
Zweige der menschlichen Erkenntnis, sie beherrsche auch
die Dichtkunst. Allenthalben trete sie mit der Anmaßung auf, dem
[Bd. b6, S. 614]
Schriftsteller vorzuschreiben, welchen Weg er hätte gehen sollen.
Dadurch aber erhielten „alle literarischen Bemühungen, auch die
von einem ganz verschiedenen Geiste ausgehenden, eine eigene und
sehr nachtheilige Richtung“ (S. 332), und in der Kritik herrsche
„ein herber Ton des Uebermuthes und Hohns“ (S. 333), der die
Freude am Besten trübe, was der Mensch besitze. Da nun diese
Bewegungen neuerdings auch fremden Völkern bekannt würden, und
von ihnen einige sich bemühten, im Gefühl der eignen Schwäche
an die Erzeugnisse der deutschen Literatur sich zu halten und
nach ihnen einen neuen Geschmack sich zu bilden, so sei die Frage
zu stellen, wohin jene Bestrebungen führen könnten. Ihre Beantwortung
müsse von einer Vergleichung der philosophischen Grundsätze
und Methoden ausgehen.
Daher handelt der Verfasser in einem ersten Abschnitt von „dem
Verhältnisse der Französischen Metaphysik zu der Deutschen“. —
August Wilhelm Rehberg wurde am 13. Januar 1757 in Hannover
geboren. Er widmete sich an den Universitäten zu Göttingen
und Leipzig dem Studium des klassischen Altertums und der neueren
Literaturen, insbesondere der englischen, mit Einschluß der geschichtlichen
und staatswissenschaftlichen, wie ihn denn überhaupt
Staatswirtschaft und Politik von früh auf anzogen. In erster Linie
aber galt seine Neigung der Philosophie, und die Metaphysik schien
es zu sein, die er vor allem bearbeiten werde. Kants „Kritik der
reinen Vernunft“ fand in ihm einen der ersten und am tiefsten
eindringenden Anhänger, der viel zu ihrer Verbreitung und Erläuterung
beitrug. So erwarb er sich eine umfassende, philosophisch
durchgebildete Gelehrsamkeit und darauf mit zahlreichen politischen
Schriften einen großen, wenn auch nicht immer günstigen Ruf.
Die Wiederkehr der rechtmäßigen Herrschaft in Hannover brachte
ihn in eine führende Stellung, und, geleitet von seinem Ideal
des altständischen Staates, betrieb er nun mit Eifer die Erneuerung
der alten Ordnung, dabei auch den neuen demokratischen Ideen
maßvollen Einfluß gewährend. Insbesondere wurde er, nachdem
er im Jahre 1814 zum Geheimen Kabinettsrate ernannt worden
war, die Seele der ständischen Reform, die die Verschmelzung
sämtlicher Provinzialstände, jedoch ohne deren Aufhebung, zu
einem einheitlichen Organ, einer allgemeinen Ständeversammlung,
zum Ziele hatte. So große Verdienste sich auch Rehberg dadurch um
das hannöversche Staatswesen erwarb, so sehr sich dabei der konservative
Grundzug seines Wesens offenbarte, den Ansprüchen des
Adels konnte er dennoch nie genügen. Eine Opposition entstand,
und dieser gelang es schließlich, ihn zu stürzen.
Rehberg lebte fortan bis zu seinem Tode im Ruhestande, viel
reisend und, wie auch immer während der Zeit seines praktischen
Staatsdienstes, die hervorragendsten Erscheinungen des politischen
Lebens und der staatswissenschaftlichen Literatur mit schriftstellerischer
Tätigkeit begleitend. Dabei zeigte er sich nicht bloß als ein
origineller, sondern auch als ein reicher Geist, ein Mann von vollendeter
Bildung; einheimisch auf dem Gebiete der Spekulation und
Abstraktion, immer bestrebt, die von ihm bearbeiteten Gegenstände
in ihrem ganzen Zusammenhange theoretisch und historisch zu
[Bd. b6, S. 615]
durchforschen, und dabei doch stets geleitet von den Bedingungen
und Bedürfnissen der realen Welt. Das eindringende Studium eines
langen Lebens verwandte er auf Ergründung dessen, was dem Staate
und dem Einzelnen gedeihlich sei; Veredelung der Menschheit,
Schonung ihrer Rechte, Aufhebung aller Mißbräuche, das ist sein
Ziel. Vor allem hebt er stets hervor, was der Beförderung echter
Moralität und der Stärkung und höhern Richtung des Charakters
nützlich oder schädlich sei. Diese sittliche Strenge bestimmt selbst
den Wert und Gehalt poetischer Werke. Das ist den praktischen
Aufgaben gemeinsam, die er als Schriftsteller verfolgt hat, daß sie
vorwiegend abwehrender Natur sind. Er selbst hat von seinem
Leben gesagt, es sei zum größten Teile dem Geschäft gewidmet
gewesen, dem Strome der öffentlichen Meinung überall dort entgegen
zu arbeiten, wo er eine falsche Richtung genommen habe.
Rehberg ist am 10. August 1836 in Göttingen gestorben.
Vgl. „Neuer Nekrolog der Deutschen“ Jg. 14. 1836. T. 1. S.
491—501; ADB Bd 27, S. 571—83 (F. Frensdorff); Treitschke,
„Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert“ T. 3. 6. Aufl.
(Leipzig, Hirzel 1908), S. 545.
Almendingen: Ludwig Harscher von Almendingen ist am 25. März
1766 in Paris geboren. Er studierte Jurisprudenz an der Universität
Göttingen, erhielt 1794 einen Ruf als Professor der Rechte
an die oranische Universität in Herborn, wurde später auch deren
Archivar und Syndikus und war daneben als Anwalt und Schriftsteller
rastlos tätig. 1803 vertauschte er die akademische Stellung
mit der eines Rats bei dem nassauischen Gesamt-Oberappellationsgericht
in Hadamar. 1811 wurde er als Vizedirektor des Hofgerichts
in Wiesbaden, ferner als Geheimreferendar im herzoglich nassauischen
Staatsministerium angestellt; 1816 als Vizepräsident an
das neuerrichtete Hofgericht in Dillenburg versetzt. Daneben war
er als Mitglied der Gesetzgebungskommission tätig. Im Jahre 1820
kam er nach Berlin, um in einem vor den preußischen Gerichten
verhandelten Rechtsstreite zwischen Mitgliedern des Fürstenhauses
Anhalt-Bernburg die eine Partei zu vertreten. Dort brachte Unvorsichtigkeit,
aus mangelnder Welt- und Menschenkenntnis stammend,
ihn in den damals landläufigen Verdacht der Demagogie. Außerdem
wurde er infolge der Heftigkeit seiner, zum Teil gedruckten
Prozeßschriften in eine Kriminaluntersuchung bei dem Berliner Kammergericht
wegen „frechen unehrerbietigen Tadels der Landesgesetze
und Anordnungen im Staat“ verwickelt und zu einjähriger
Festungshaft verurteilt. Man vollstreckte zwar die Strafe nicht, erteilte
ihm aber einen Verweis und gab ihm den Abschied. Seine
unermüdlichen Bemühungen um Rehabilitation waren vergeblich.
Schon früher hatte er sich mit mehreren seiner Freunde überworfen
und war, da er in seinen schriftstellerischen Fehden von Leidenschaftlichkeit
und Unduldsamkeit gegen fremde Ansichten sich nicht
frei zu halten wußte, auch eine gewisse Überheblichkeit und Betriebsamkeit
in wissenschaftlichen Kreisen heftigen Anstoß erregt
hatte, in eine Art von literarischer Verfehmung geraten. Die Ideen,
deren Verwirklichung er ersehnte, Preßfreiheit, konstitutionelle Verfassung,
öffentliche Rechtspflege, schienen der Ungunst der Verhältnisse
[Bd. b6, S. 616]
zum Opfer gefallen zu sein. So starb er in tiefster Verbitterung
am 16. Januar 1827 in Dillenburg.
Almendingen darf unbestritten — so urteilt Wilhelm von der
Nahmer — zu den Vorkämpfern seiner Epoche gerechnet werden.
„Er nahm lebendigen Theil an Allem, was die Zeit bewegte. Nicht
blos das Recht, wie es gerade ist, sondern auch wie es sein sollte,
und zwar alle Theile der Rechtswissenschaft, Civilrecht, Criminalrecht
und Prozeß, römisches, deutsches und französisches Recht, Staatswissenschaften,
Geschichte und Politik umfaßte sein rastloser Geist
[...] Schon seine philologischen Kenntnisse hätten hingereicht, um
einen vollständigen Gelehrten auszurüsten. [...] Den schönen Wissenschaften
war er nichts weniger als fremd, mit den Classikern
der deutschen und andrer Nationen wol bekannt, auch in die
philosophischen Systeme nicht minder eingeweiht. Diese seltene Vielseitigkeit
von Kenntnissen blickt in allen seinen Schriften durch.
Mit Gelehrsamkeit verband er eine lebendige Phantasie, seltenen
Scharfsinn und eine logische Gewandtheit, die ihres Gleichen suchte.
Aus den von ihm angenommenen Prämissen zog er regelrecht, mit
unermüdlichem Fleiße, alle nur möglichen Folgerungen. Waren daher
seine Vordersätze richtig, so flossen seine Ideen mit der größten
Klarheit und Vollständigkeit.“ Allerdings wirkten „Almendingens
reiche Einbildungskraft, sein lebhafter und reizbarer Charakter auf
die factischen Grundlagen, wovon er ausging, nachtheilig“ ein. „Das
Thatsächliche, was er als wahr annahm, war nicht immer richtig.
Seine Entwickelungen a priori waren classisch. Sobald er aber a
posteriori urtheilen wollte, wirkte nicht selten Mangel an zureichender
praktischer Kenntniß nachtheilig ein“. „Allein selbst seine
Irrthümer vertheidigte er mit solchem Scharfsinn, daß sie zur Erforschung
und Vertheidigung der Wahrheit aufregten.“
Seine literarischen Hauptleistungen sind die folgenden:
1) Als in den Rheinbundstaaten die Einführung des Code Napoléon
betrieben wurde, war Almendingen einer der Wenigen, welche
die außerordentliche Bedeutung dieses Schrittes für das gesamte
Staats- und Volksleben klar erkannten. Die Rezeption selbst hielt
er für bedenklich, aber unvermeidlich. So bekämpfte er wenigstens
die Meinung vieler, daß der Code sich ohne Weiteres auf Deutschland
übertragen lasse, und betonte, daß dies nur unter gleichzeitiger
Einführung seiner organischen Umgebungen, wie öffentliches Verfahren,
Notariat, angemessene Umänderung der Administration, möglich
sei, so, wie es dem deutschen Charakter und dem Bedürfnis
des deutschen Volkes zusage.
2) Auf politischem Gebiete ist seine gediegenste und ausführlichste
Schrift der erste Band der (1814 bei Schellenberg in Wiesbaden
erschienenen) „politischen Ansichten über Deutschlands Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft“.
3) In der Lehre vom Zivilprozeß vertrat er als einer der Ersten
die Richtung, welche im Gegensatze zu der Weise des achtzehnten
Jahrhunderts den Grundgedanken des Systems nachforschte und sie
zur Belebung und Erklärung des toten Materials zu verwerten suchte.
Der „Versuch einer Metaphysik des Civilprocesses“ (= Bd. 4
der „juristischen und staatswissenschaftlichen Schriften“. Gießen,
[Bd. b6, S. 617]
Müller 1808. 2. Aufl. 1819) ist auf diesem Gebiete sein bekanntestes
Werk.
4) Neben Feuerbach und Grolmann kommt ihm ein großer und
bedeutsamer Anteil an der damaligen Umschaffung des Kriminalrechts
zu. Mit ihnen zusammen gab er die „Bibliothek für die peinliche
Rechtswissenschaft“ heraus; ihm und Grolmann hat Feuerbach
sein weltberühmtes „Lehrbuch des peinlichen Rechts“ gewidmet.
Vgl. Wilhelm von der Nahmer: „Zeitgenossen“ 3. Reihe, Bd 1
(1829), H. 5/6, S. 77—120, die angeführten Stellen S. 99—100;
ADB Bd 1, S. 351—52 (Göppert).
1) Der Verfasser nennt sich nur in der Nr 97, am Schlusse des
ersten Artikels.
1) Ludmilla Assing setzt den Brief unter die aus dem Jahre 1832.
Sollte er nicht vielmehr dem folgenden angehören? Man vergleiche
das Datum von Pücklers Antwort! Die Reihenfolge, in die die Herausgeberin
diese Briefe gebracht hat, bedürfen ja auch sonst mancher
Korrektur. (Vgl. dazu auch Hans von Müller, „E. T. A. Hoffmann
im persönlichen und brieflichen Verkehr“ II,3. Berlin, Paetel 1912.
S. 598, in Anm. 2 zu S. 596.)
1) Der Fürst vergleicht in seinem Briefe Bettinen mit einem leidenschaftlichen
Schützen, der in Ermangelung des Wildes sein Pulver
auf einen gemalten Hirsch verschießt; er will damit sagen, daß alle
ihre Briefe, mit Ausnahme des letzten, ihn nur zum scheinbaren
Gegenstande gehabt hätten.
2) Während ihres Aufenthaltes in Muskau hatte Bettine dem Fürstenpaare
aus ihrem Werke vorgelesen.