Es ging mir gestern wie Ihrem Kay, nach dessen Namen zu schließen, Sie an Kyau gedacht haben, und ich wußte nicht, ob ich geträumt oder gewacht hatte, Gold erhalten zu haben. — Der Oberon hat mir gefallen, und sind die Sänger und 5Sängerinnen à la der coquetten Sonntag und des Juden Paganini etc auch nicht Extreme, so übertreiben sie doch nicht, und spielen für Sänger sehr gut. Daß Sie und eine Malerschule in Düsseldorf ist, sieht man immer mehr auch an der Scenerie. — Morgen liegt meine Beurtheilung Ihrer Werke zu Ihrer 10Ueberbeurtheilung vor Ihnen, — wahrscheinlich ganz, denn ich bin schon mit der Recension mitten im 3. Bande. Sie müssen auch Rath geben, wo Sie ihn bei der Lectüre meines Aufsatzes nöthig halten. Sollte denn der Poet nicht das Recht haben, was jeder Fabricant hat, seiner Sachen Eigenthümliches 15bemerklich zu machen? Poesie soll zwar etwas Göttlicheres seyn und ist es, und Gott soll sich nicht erklären. Ich glaube er thut's aber doch: in uns, in Sternen, Blumen, auch in Christus mehr als Paulus in Heidelberg vernunftgläubig saalbadert. — Mit dem Hannibal ist es was Schlimmes: ich habe 20fast nur noch erschütternde Scenen, eine auf die andere, und sie stoßen mich vorwärts, daß ich glaube er ist noch nächste Woche fertig, aber hole der Geier die Schlegel und nicht auch dichtenden Kritiker mit ihrer Meinung: „der Poet schreibe alles so kalt hin.“ Grade das was am Objectivsten scheint, ist 25oft das Subjectiveste, soll man diese dummen Worte, die sich ineinander verwirren, einmal gebrauchen. Ich kann versichren, daß ich den Hannibal immer in Ordre halten muß, damit er nicht bei mir einhaut. Auch habe ich einige Ruhebänke in Campaniens sonnenhellen Fluren eingeschoben.
|
  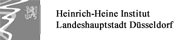 | © 2009—2011 by Lippische Landesbibliothek - Theologische Bibliothek Detmold, Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier und Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf Home | Impressum | Kontakt |

506.
H: 2 Bl. in 40; 3 S.
F: IW Bl. 47. 48. (44. 45.)
D: TdrO S. LVII—LVIII, als Nr 9.
Das richtige Datum des 18. Januar ergibt sich aus dem der Aufführung
des „Oberon“, die Grabbe am Abend zuvor besucht hat.
Nach Fellner (S. 352) hat sie an einem Freitag stattgefunden, und
dieses war der 17. Januar.
S. 137, Z. 12: Sie] sie H
S. 137, Z. 1: Es ging mir gestern wie Ihrem Kay [usw.]: In der,
in „einem andren Theil der Schlucht“ spielenden Szene des Hauptteils
des „Merlin“, benannt „Der Gral“, tritt Kay, der Truchseß von
Artus' Tafelrunde, auf, stellt sich als Hofmarschall und Exzellenz
vor und bezeichnet seinen Auftrag:
„Beschaffen soll das Kind ich ohne Vater,
Und an den Hof verpflanzen dieß Gewächse!“
Sein Monolog schließt mit den Versen:
„Es ist durchaus ganz sonderbar und eigen,
Daß Alles auf der Welt sich unterscheidet.
So wird behauptet, daß die Fische schweigen,
Und daß die Gans das Schnattern nicht vermeidet,
Auch schreit der Esel: Yah! und das Faulthier: Ay!
Hofnarr ist Kyaw, und Hofmarschall, Kay.“
Darauf entschläft er. So sieht ihn Merlin und spricht:
„Da liegt der Ritter,
Den der König sandte nach dem Wunder.
Sollst Dir die Füße nicht laufen wunder.“
Er zieht ein goldenes Täflein hervor, schreibt und legt es dem
Kay in die Hand. Dieser erwacht. Ihm ist, als ob er vom Paradiese
geträumt habe. Er wird des Täfleins in seiner Hand gewahr, und
beschließt, sich zu Klingsor zu begeben, damit der ihm den Sinn
der Charaktere deute. Dann aber kommen ihm Zweifel, ob dies
Wirklichkeit sei, und er ruft sich selbst zu:
„Doch halt! Schlaf' ich wohl noch? Bin ich schon kindisch?“
Erst nachdem er mit der Stirn gegen einen Felsen gerannt ist,
kommt ihm die Gewißheit:
„Ich wache, bin vernünftig.“
(„Merlin. Eine Mythe.“ Düsseldorf, Schaub 1832. S. 74—80.)
Kyau: Friedrich Wilhelm Freiherr von Kyaw (vielfach Kyau geschrieben),
geb. am 6. Mai 1654, gest. am 19. Jan. 1733 als Kommandant
der kursächsischen Festung Königstein. Es ist ein wegen
seines Witzes, seiner nie versiegenden Laune und seiner lustigen, nach
dem Charakter der Zeit zuweilen etwas derben Streiche vielgenannter
Mann. Jedoch werden manche der zahlreichen Anekdoten und
Schwänke, die in den über ihn erschienenen Schriften von ihm erzählt
werden, auf fremde Rechnung gehören. „Mit Unrecht ist er
[Bd. b6, S. 487]
häufig den lustigen Räthen zugezählt worden; dazu stand seine Persönlichkeit
zu hoch, war sein Charakter zu edel angelegt.“ (Poten,
ADB Bd 17, S. 444—45.)
S. 137, Z. 9: meine Beurtheilung Ihrer Werke: Diese ist nicht
bekannt.
S. 137, Z. 17—19: auch in Christus mehr als Paulus in Heidelberg
vernunftgläubig saalbadert: Heinrich Eberhard Gottlob P.
(1761—1851) hatte, im Gegensatze zu seinem Vater, schon als Klosterschüler
(in Blaubeuren und Bebenhausen) einen streng rationalen
Weg des Denkens eingeschlagen und hat diesen Rationalismus auf
dem Gebiete der neutestamentlichen Exegese aufs konsequenteste
durchgeführt. „Davon, daß die Religion ein unmittelbares, im Gemüt
wurzelndes Leben sei, hatte er keinen Begriff. Wo er die Religion
in dieser Gestalt sah, war er geneigt, Pietismus, Mysticismus u. s. w.
zu finden. Die Religion war ihm ein Wissensakt.“ (Kahnis u. P.
Tschackert, „Realencyklopädie für protestantische Theologie u. Kirche
“, 3. Aufl., Bd 15, Leipzig 1904, S. 90.) In seiner vierten, 1788
herausgegebenen Musterpredigt heißt es:
„Die Glaubenspflicht des Christen geht auf nichts, als auf die
gewissenhafteste Anwendung des Verstandes zur unbezweifelten
Erkenntniß der Christuslehre.“ (Karl Alexander Freiherr von Reichlin
-Meldegg, „Heinrich Eberhard Gottlob Paulus u. seine Zeit“.
Bd 1. Stuttgart, Verlags-Magazin 1853, S. 75.) „Ist die Religion
wesentlich ein Wissen von Gott, so kommt alles darauf an, daß ihr
Inhalt wahr sei. Wahr aber ist nur das Begreifliche und Erweisliche.
“ Dieser Aufklärer blieb P. bis zu seinem Tode. Der tiefere
Gang, den die neuere Philosophie seit Kant genommen, berührte
ihn eben so wenig, wie der Umschwung des religiösen, sittlichen und
politischen Lebens in Deutschland. „Er blieb bei seinem Denkglauben.
Und was war der Denkgläubige? Ein ehemaliger Kollege von
Paulus sprach es schlagend aus: Ein Mann, der zu glauben denkt
und zu denken glaubt. Es war weder Denken noch Glaube in diesem
Denkglauben.“ (Kahnis u. Tschackert, a.o.O. S. 90, 92.) Wenn nach
dieser allgemeinen Charakteristik überhaupt noch ein Werk besonders
angeführt werden soll, so kommt in erster Linie des Paulus
bedeutendste Schrift aus der Heidelberger Zeit in Betracht: „Das
Leben Jesu als Grundlage einer reinen Geschichte des Urchristenthums
“ (2 Bde., 1828); daneben die gelehrte Ergänzung, nämlich
das „Exegetische Handbuch über die drei ersten Evangelien“ (3 Bde.
1830—33).
S. 137, Z. 22—24: hole der Geier die Schlegel [usw.]: Eines
der Lyceums-Fragmente Friedrich Schlegels beginnt mit den Sätzen:
„Um über einen Gegenstand gut schreiben zu können, muss man
sich nicht mehr für ihn interessiren; der Gedanke, den man mit Besonnenheit
ausdrücken soll, muss schon gänzlich vorbey seyn, einen
nicht mehr eigentlich beschäftigen. So lange der Künstler erfindet
und begeistert ist, befindet er sich für die Mittheilung wenigstens
in einem illiberalen Zustande. Er wird dann alles sagen wollen;
welches eine falsche Tendenz junger Genies, oder ein richtiges Vorurtheil
alter Stümper ist.“ („Friedrich Schlegel 1794—1802. Seine
prosaischen Jugendschriften.“ Hrsg. von J. Minor. Bd 2 Wien 1882.
S. 187, unter Nr 37.) — Mit dem Begriffe der Objektivität als
[Bd. b6, S. 488]
einer Forderung der Kunst hat sich Schlegel in seiner Abhandlung
„Über das Studium der griechischen Poesie“ vom Jahre 1797 auseinandergesetzt.
Nur in dieser Poesie findet er das Allgemeingültige,
das Objektive und Schöne, während er die moderne, als deren
Stellvertreter ihm vornehmlich Shakespeare erscheint, wegen der
Herrschaft des Manierierten, Charakteristischen und Individuellen
als interessant bezeichnet. In der Mitte zwischen dem Interessanten
und dem Schönen, zwischen dem Manierierten und dem Objektiven
steht, wie er meint, Goethe. Die Bildungsgeschichte der modernen
Poesie stelle nichts andres dar, als „den steten Streit der subjektiven
Anlage, und der objektiven Tendenz des
ästhetischen Vermögens und das allmählige Uebergewicht des letzteren.
Mit jeder wesentlichen Veränderung des Verhältnisses des
Objektiven und des Subjektiven“ beginne eine neue Bildungsstufe.
Zwei große Bildungsperioden habe die moderne Poesie schon wirklich
zurückgelegt; jetzt stehe sie am Anfange der dritten. (A.a.O.
Bd 1, Wien 1882, S. 115, 171.) Im siebenten seiner Lyceums-Fragmente
hat Schlegel später seinen Versuch über das „Studium der griechischen
Poesie“ einen „manierirten Hymnus in Prosa auf das Objektive
in der Poesie“ genannt, und hinzugefügt: das Schlechteste daran scheine
ihm „der gänzliche Mangel der unentbehrlichen Ironie; und das
Beste, die zuversichtliche Voraussetzung, dass die Poesie unendlich
viel werth sei; als ob dies eine ausgemachte Sache wäre.“ (A.a.O.
Bd 2, S. 184.) In seiner (handschriftlichen) Münchener Dissertation
über „Friedrich Schlegels Theorie von der romantischen Objektivität
“ vom 15. Juni 1923 hat Julius Goetz versucht, den Zusammenhang
klarzulegen, in dem Schlegels früheste Ansichten über die
dichterische Objektivität mit seiner Theorie der romantischen Ironie
stehen.